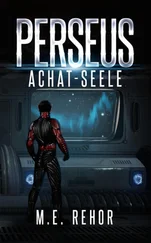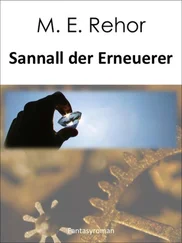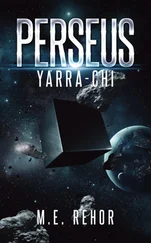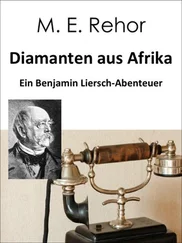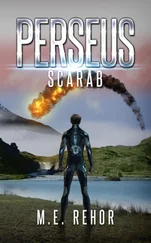„Der Wind der Steppe“, echote Saika.
Tur erklärte: „Eine poetische Beschreibung für ein Netzwerk zwischen den Anführern der Stämme. So werden Informationen von Küste zu Küste weitergeleitet. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Es sind höchstens zwei Dutzend Menschen, die über euch Bescheid wissen.“
„Verschwiegene Männer und Frauen“, ergänzte Aqlorr, „die ihre Verantwortung kennen. Wir kümmern uns normalerweise nicht um das, was im grünen Bereich dieses Kontinents geschieht. Wer regiert und wer die Regierung bekämpft, hat nichts mit unserem Leben zu tun. Das scheint sich nun zu ändern, wir fühlen uns bedroht. Deshalb suchen wir eure Unterstützung.“
„Bedroht von wem?“, fragte Macay.
„Von der karolischen Regierung. Hast du davon gehört, wie weit die technische Entwicklung in den letzten Jahren in der Hauptstadt Aragotth vorangeschritten ist? Nun greift sie hinaus ins Land. Man will Eisentrassen verlegen, um schnell überall hinzukommen. Man wird auch uns nicht mehr in Ruhe lassen, wenn eine Reise von Aragotth zu unserem Stammesgebiet nur noch einen Tag dauert. Unser Lebensraum ist bedroht, weil die Steppe Rohstoffe birgt, die von den Manufakturen in Aragotth benötigt werden.“
„Es könnte euch reich machen, wenn man diese Rohstoffe auf eurem Stammesgebiet fördert“, gab Saika zu bedenken.
„Das Land gehört nicht uns. Es gehört, wenn man nach den Papieren fragt, niemandem. Und das wiederum bedeutet, es gehört der Regierung, die damit machen kann, was sie will. Sie wird für die Nutzung nichts bezahlen.“
„Aber wie stellt ihr euch vor, dass Saika und ich euch helfen können?“, fragte Macay.
Aqlorr lächelte: „Es ist wie mit den Stämmen. Einer mag schwach sein, aber wenn alle zusammenarbeiten, stellen sie eine Macht dar. Kedorrah ist eine kleine Stadt, aber es gibt viele kleine Städte auf dem karolischen Kontinent, in denen unzufriedene Menschen leben.“
Unvermittelt hob Tur die Hand. Sofort schwiegen die anderen. Nach ein paar Sekunden sagte er: „Von Norden kommen Reiter. Es sind keine Männer der Steppe.“
Obwohl Macay sein Gehör anstrengte, hörte er nichts außer dem Wind, der leise durch das Gestrüpp und die dürren Bäume wehte.
„Wir räumen unser Lager“, fuhr Tur fort. In ungewohnter Hast hob er die wenigen Dinge auf, die herumlagen, und ging zu den Pferden.
Aqlorr, Macay und Saika folgten ihm.
„Wohin reiten wir?“, fragte Macay.
„In die Wüste“, sagte Tur. „Das ist die perfekte Falle für Gegner, die sich dort nicht auskennen.“ Er sah prüfend zu den Dünen hinüber.
Aqlorr schien Turs Gedanken zu erraten. „Du hast ihn also schon gerochen!“, sagte er. „Es ist riskant. Aber wer auch immer uns verfolgt, wird es bereuen.“
„Dann los!“
Sie saßen auf.
„Wovon redet ihr?“, fragte Macay.
„Still!“, rief Tur zurück. „Bleibt genau in meiner Spur, weicht keinesfalls davon ab.“
Sie ritten ein paar Hundert Schritte nach Osten und dann in eine Senke zwischen zwei Dünen hinein. Diese Senke führte mäandernd nach Süden. Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit wandte sich Tur wieder nach Westen. Schließlich hielt er an.
„Dort oben ist ein guter Platz“, sagte er und deutete auf eine besonders hohe Düne. „Unsere Verfolger sollen sehen, wo wir sind. Aber wir dürfen sie nicht zu offensichtlich anlocken, sonst werden sie misstrauisch. Ich gehe alleine.“
„Ich will mit“, sagten Macay und Saika gleichzeitig.
„Dann bleibe ich bei den Pferden“, bot Aqlorr an. „Die Tiere sind unruhig. Sie riechen die Gefahr.“
„Welche Gefahr?“, fragte Saika. Sie bekam keine Antwort.
Tur ging schräg die Düne hoch. Kurz vor dem Dünenkamm legte er sich flach auf den Sand und robbte bis ganz nach oben. Macay und Saika taten es ihm nach.
Nun lagen sie so wie vor einer Stunde schon einmal, aber sie sahen in die entgegengesetzte Richtung: von der Wüste aus nach Norden in die Steppe hinein.
Sie befanden sich genau südlich ihres bisherigen Lagerplatzes. Macay konnte sehen, wie dort mehrere Reiter eintrafen. Sie waren bewaffnet und mit Lederharnischen gerüstet, doch dem Aussehen nach weder den Stämmen noch dem karolischen Militär zuzuordnen. Die Reiter entdeckten die Spuren der Pferde, folgten ihnen aber nicht.
„Ihr beiden bleibt in Deckung!“, sagte Tur. Dann richtete er sich auf, so dass er vom Lagerplatz gesehen werden konnte. Er tat, als würde er suchend in eine andere Richtung blicken und die Soldaten nicht bemerken.
Es dauerte eine Minute, bis die Bewaffneten ihn sahen. Sie schrien sich gegenseitig zu, auf ihn zu achten. Tur tat, als würde er jetzt erst sehen, dass er nicht alleine war, und ließ sich fallen.
Macay sah, wie die Männer nun auf sie zuritten. Sie folgten nicht der Spur der Pferde, sondern nahmen den direkten Weg. Dabei mussten sie allerdings zwei Dünen überwinden, deshalb verschwanden sie gleich wieder aus dem Blick.
Tur sagte zufrieden: „Die Falle schnappt zu.“
„Sollten wir nicht besser verschwinden?“, fragte Saika.
„Nein. Schau!“
Die Soldaten erreichten den ersten Dünenkamm und hielten an. Macay dachte, die Männer wollten sich neu orientieren. Dann sah er, dass die Reiter ihre Pferde kaum im Griff hatten. Die Tiere weigerten sich, weiterzugehen. Sie bäumten sich auf und versuchten, kehrt zu machen.
Der Sand vor den Pferden kam ins Rutschen. Doch das war nicht die Folge der wilden Bewegungen der Tiere. Der Sand rutschte, weil sich etwas von unten ans Tageslicht hocharbeitete. Etwas Riesiges! Etwas Stinkendes, wie Macay gleich darauf feststellte, noch bevor er sehen konnte, was es war.
Zwei schwarze Greifer schnellten unter dem Sand hervor. Sie sahen grauenhaft aus; wie mehrere Meter lange, gepanzerte Arme, über und über mit Dornen besetzt. Vorn streckten sich zangenartige Klauen den Pferden und ihren Reitern entgegen.
Saika schrie laut auf vor Schreck. Macay nahm es ihr nicht übel. Die Zangen griffen zu. Sie waren messerscharf und zerschnitten ihre Opfer mühelos. Egal, ob Pferd oder Reiter, es gab keine Überlebenschance. Das Monster, von dem noch immer nur die Greifarme zu sehen waren, kümmerte sich nicht um seine ersten Opfer. Sobald diese zerfetzt in ihrem Blut lagen, griffen die Zangen sich die nächsten. Der Angriff dauerte nur Sekunden, dann waren alle Pferde und Reiter tot.
Nun erst tauchte der Körper des Tieres unter dem Sand auf. Er war schwarz und mit Stacheln bewehrt. Die Augen seines winzigen Kopfes glitzerten in der Sonne. Es waren die Augen eines Insekts. Erstaunt sah Macay, dass der Körper des ganzen Tieres kaum länger war als die beiden Greifarme, die es wie groteske, steife Tentakel schwenkte.
Mit diesen Greifarmen scharrte es nun die Überreste seine Opfer zusammen und ließ sie in das Loch fallen, aus dem es hervorgekrochen war. Abschließend sah es sich noch einmal um. Einen Moment lang befürchtete Macay, das Tier könnte ihn entdecken und angreifen. Doch es schlüpfte zurück in das Loch. Dabei wedelte es mit seinen kurzen Hinterbeinen. So brachte es den Sand der Düne ins Rutschen, bis sich die Stelle, an der es gewesen war, kaum mehr von der Umgebung unterschied.
„Wir können zurückkehren zu unserem Lagerplatz“, sagte Tur. Er musste der entsetzten Saika aufhelfen.
„Was war das?“, fragte Macay.
„Ein Aasgreifer“, antwortete Tur. „Sie leben normalerweise nicht so nahe am Wüstenrand, denn sie nutzen die großen Dünen als Nest.“
„Wird er uns angreifen?“
„Nein. Aasgreifer bleiben bei ihrem Nest. Eigentlich ist das da vor uns gar keine Düne. Es ist das riesige Nest des Tieres. Der Sand, den der Wind darüber geweht hat, lässt es wie eine Düne aussehen. Der Aasgreifer lebt von dem, was über sein Nest wandert. Normalerweise sind das irgendwelche Tiere. Aber wenn der Aasgreifer Glück hat, dann gehören auch mal Menschen und Pferde zu seinen Opfern.“
Читать дальше