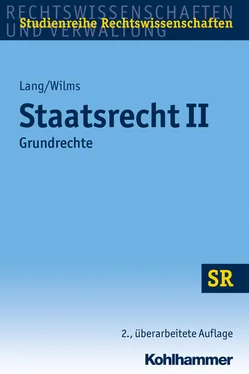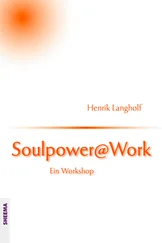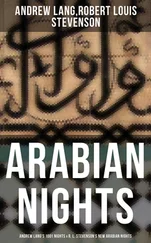Im Lüth-Urteil hat das BVerfG darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber die Verfassungsbeschwerde als besonderen Rechtsbehelf zur Wahrung der Grundrechte an sich nur gegen Akte der öffentlichen Gewalt gewährt hat. 51Zugleich hat der Senat jedoch ausdrücklich festgestellt, dass das GG keine wertneutrale Ordnung sein will, sondern in seinem Grundrechtsabschnitt auch eine objektive Wertordnung aufgestellt hat. 52Dieses Wertsystem
„muss als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gelten; Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung empfangen von ihm Richtlinien und Impulse. So beeinflusst es selbstverständlich auch das bürgerliche Recht; keine bürgerlich-rechtliche Vorschrift darf in Widerspruch zu ihm stehen, jede muss in seinem Geiste ausgelegt werden.“ 53
167Das BVerfG vertritt seither in ständiger Rechtsprechung die „ Lehre von der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte “. In späteren Entscheidungen sprach das Gericht wertneutral von „Elementen objektiver Ordnung“, 54die als „objektive Grundentscheidungen für alle Bereiche des Rechts, also auch für das Zivilrecht, gelten“, 55ohne dass damit ein Unterschied in der Sache einherginge. 56
168Die Ausstrahlungswirkung der Grundrechte auf das bürgerliche Recht hat zur Folge, dass das einfache Gesetzesrecht im Lichte der besonderen Bedeutung der Grundrechte auszulegen ist . 57Daraus können sich grundrechtliche Schutzpflichten ergeben. 58Als „Einbruchstellen“ der Grundrechte als Auslegungsdirektiven dienen vor allem unbestimmte Rechtsbegriffe (vgl. § 315 BGB) sowie die zivilrechtlichen Generalklauseln (§§ 138, 242, 826 BGB). 59Eine unmittelbare Grundrechtsbindung Privater lehnt die h. M. demgegenüber ab, sofern eine solche nicht, wie in Art. 9 Abs. 3 S. 2, ausdrücklich im GG vorgesehen ist. 60
VI.Die deutschen Grundrechte und die supranationale Hoheitsgewalt der EU
169 Art. 1 Abs. 3 hat nach allgemeiner Auffassung nur die Grundrechtsbindung der deutschen Staatsgewalt zum Gegenstand. 61Ausländische Staaten und supranationale Organisationen wie die Europäische Union sind daher nicht an den Grundrechtskatalog des Grundgesetzes gebunden. 62
170Das Rangverhältnis von Europarecht und nationalem Verfassungsrecht ist für die Frage von Bedeutung, ob europäisches Sekundärrecht an den Grundrechten des Grundgesetzes zu messen ist. 63Im Kern geht es um die Kompetenzabgrenzungsprobleme , die sich namentlich aus dem Hineinwirken des Unionsrechts in das mitgliedstaatliche und damit eben auch deutsche (Verfassungs-)Recht ergeben. 64 Prozessrechtlich hat das etwa im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung einer Verfassungsbeschwerde – dort bei der Bestimmung des Beschwerdegegenstandes bzw. der Prüfung der Beschwerdebefugnis 65– oder im Rahmen der Zulässigkeitserörterung eines abstrakten Normenkontrollverfahrens – dort bei der Klärung des Verfahrensgegenstandes 66– Bedeutung. 67
Hinweis: In der Fallbearbeitung muss man sich also darüber klarwerden, was in einem bundesverfassungsgerichtlichen Verfahren als Prüfungsmaßstab und was als -gegenstand fungiert.
171 Nach Auffassung des EuGH 68hat das Gemeinschaftsrecht stets Vorrang vor dem nationalen Recht, also auch vor dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten. Denn
„dem aus dem Vertrag als einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht können wegen dieser seiner Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen, wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll.“ 69
172Demnach soll das BVerfG nicht befugt sein, Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft auf ihre Vereinbarkeit mit den Grundrechten des Grundgesetzes zu prüfen:
Nach gefestigter Rechtsprechung [scil.des EuGH] kann nämlich nach dem Grundsatz des Vorrangs des Unionsrechts, der die Unionsrechtsordnung wesentlich prägt […], die Geltung des Unionsrechts in einem Mitgliedstaat nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass dieser Staat Vorschriften des nationalen Rechts, und haben sie auch Verfassungsrang, geltend macht […].“70
173Nach Auffassung des BVerfG sind die Abgrenzungsfragen dagegen aufgrund einer mehrfachen Differenzierung zu beantworten. Zunächst ist hinsichtlich der Anwendbarkeit des Prüfungsmaßstabes der deutschen Grundrechte und damit der (verfassungsgerichtlichen) Überprüfung danach zu unterscheiden, ob Prüfungsgegenstand das sog. europäische Primärrecht (nachfolgend 1.) ist oder ob es um die Kontrolle daraus abgeleiteten Sekundärrechts geht (nachfolgend 2.). Sodann sind die verbleibenden verfassungsgerichtlichen Kontrollvorbehalte darzustellen (nachfolgend 3.).
1.Europäisches Primärrecht
174Das europäische Primärrecht wird in erster Linie durch die Verträge (etwa AEUV, EUV etc.) 71sowie das Gewohnheitsrecht 72(vor allem die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Unionsrechts) gebildet. Rechtsakte der EU als solche sind nicht von Art. 1 Abs. 3 erfasst und damit nicht Gegenstand der Bindungswirkung des Grundgesetzes und insbesondere seiner Grundrechte. 73Das BVerfG kann also nicht über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Vorschrift des Gemeinschaftsrechts entscheiden. 74
Das europäische Primärrecht ist durch völkerrechtliche Verträge entstanden und wird heute durch die Änderungen dieser Verträge fortentwickelt. Die dafür erforderlichen Zustimmungsgesetze stellen, weil insoweit der deutsche Gesetzgeber in Ausübung deutscher Staatsgewalt tätig wird, Akte der deutschen Staatsgewalt dar und können als solche auch vom BVerfG überprüft werden. 75
2.Europäisches Sekundärrecht
175Bei sog. Sekundärrecht handelt es sich um Recht, das auf Grundlage des Primärrechts von den Organen der Europäischen Union geschaffen wird. Diese können sich dabei der in Art. 288 AEUV genannten Instrumente, Verordnungen, Richtlinien etc. bedienen.
3.Verbleibende Kontrollvorbehalte und Reservefunktion des BVerfG
176 a) im Wesentlichen vergleichbarer Grundrechtsschutz.Die Dinge komplizieren sich bei der Kontrolle des Sekundärrechts durch weitere Differenzierungen.
177 aa) Kontrolle des europäischen Sekundärrechts selber.Historisch stand im Vordergrund der bundesverfassungsgerichtlichen Kontrolle zunächst die Sicherung der Grundrechte gegenüber der Rechtssetzung der EU. Sie verbindet sich mit dem bekannten Schlagwort der sog. Solange-Rechtsprechung des BVerfG. Nach dieser Rechtsprechung prüft das Gericht abgeleitetes Gemeinschaftsrecht nicht mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes,
„solange die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Gemeinschaften einen wirksamen Schutz der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften generell gewährleisten, der dem vom Grundgesetz als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist.“ 76
178Während das BVerfG im Jahre 1974 davon ausging, dass das Gemeinschaftsrecht noch keinen Grundrechtsschutz bietet, der dem Grundrechtsstandard des GG vergleichbar war ( Solange I ) 77, sah das Gericht im Jahre 1986 diese Voraussetzung nunmehr als erfüllt an, ging also von einem im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz auf europäischer Ebene aus und zog daraus folgende Konsequenz, dass solange dieser Gleichklang besteht,
„…das Bundesverfassungsgericht seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht, das als Rechtsgrundlage für ein Verhalten deutscher Gerichte und Behörden im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, nicht mehr ausüben und dieses Recht mithin nicht mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes überprüfen [wird]; entsprechende Vorlagen nach Art. 100 Abs. 1 GG sind somit unzulässig.“ 78
Читать дальше