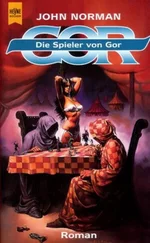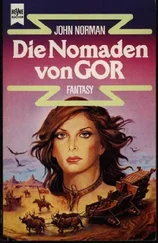Die anderen Männer lachten. »Kajira«, bemerkte einer.
Dann wurde ich dem nächsten übergeben.
Jetzt hockte ich in meine Decke gewickelt im stillen Lager und dachte nach. Kajira, hatte einer der Männer gesagt.
Ich war wütend. Mich einem von ihnen hingegeben zu haben, konnte ich mir nicht verzeihen. Ich wollte mir einreden, es sei nicht geschehen. Es konnte nicht passiert sein, also war es auch nicht passiert ... und doch, es war geschehen, wie ich in Wirklichkeit und insgeheim wusste. Ich hatte mich einem von ihnen hingegeben. In seinen Armen hatte ich, die einst Judy Thornton gewesen war, gelegen und mich ihm hingegeben. Eine zum Vergnügenschenken gezwungene Sklavin hatte geweint und sich in den Armen eines Herrn aufgebäumt. Ich schämte mich zutiefst! Ich fragte mich, was dies bedeuten mochte. Ließen sich die Gefühle leugnen, die mich überwältigt hatten – die sinnliche Wahrheit, die Erhabenheit biologischer Unterwerfung, welche sich so sehr von jener des Mannes, seiner Dominanz unterschied und in deren Glanz ich gebadet hatte? Ich nahm mir vor, solche Schwächen, die meine Persönlichkeit zum Gespött machten, nicht mehr zuzulassen. Ich durfte einem Mann nicht noch einmal nachgeben. Mir fiel wieder Elicia Nevens ein. Sie hätte beim Anblick ihrer reizenden Konkurrentin Judy Thornton gelacht, die als gebrandmarkte Sklavin rücklings im Dreck lag, in den Wehen der Unterjochung durch einen Mann, aufs Schändlichste machtlos in seinen Armen, unbeherrscht und nicht mehr Herrin ihrer selbst, hingerissen von seiner Männlichkeit. Daraufhin wusste ich, dass ich flüchten musste. Dies sollte schwierig werden, weil ich gezeichnet war.
Ich schaute wieder hinauf zu dem Wachmann. Er beachtete mich nicht, also schlich ich zur Felswand und untersuchte sie im Mondlicht. Es gab keine Stelle, an der ich weiter nach oben gekommen wäre als ein Yard. Ich kratzte mit den Fingernägeln am Granit.
Danach drehte ich mich zu dem Wall aus Dornensträuchern um. Er war imposant: hoch und dick.
Der Wächter schaute mir nicht zu. Er hatte sich nicht ums Lager zu kümmern, sondern beschäftigte sich mit etwas anderem – möglichen Angriffen, die von den Feldern hinter den Tälern ausgehen könnten.
Plötzlich schrie ich vor Schmerz auf; Angst schwang ebenfalls mit, denn die Hecke gab unter mir nach. Sie trug mein Gewicht nicht, und jetzt steckte ich sowohl mit dem rechten Bein als auch dem rechten Arm tief darin fest. Ich drehte den Kopf zur Seite und hielt die Augen geschlossen, spürte die Dornen, die mich zu durchbohren schienen. Ich hing zur Hälfte im Gebüsch, saß in der Falle und wagte nicht mehr, mich zu bewegen. Dann fing ich zu weinen an und schrie weiter. Mein Herr erreichte mich zuerst. Er amüsierte sich köstlich über meinen Anblick, und ich verstummte sofort. Ein zweiter Mann kam mit einer Fackel, mit der er in der Glut des Feuers gescharrt hatte, bis sie angegangen war. Mehrere andere wurden wach, kehrten aber sogleich in ihre Zelte und auf ihre Felle zurück, als sie sahen, dass es nur um eine Sklavin ging. Eta eilte herbei, kehrte jedoch auf ein strenges Wort meines Herrn hin prompt zu ihrem Schlafplatz zurück.
»Ich hänge fest, Herr«, klagte ich.
Mein Fluchtversuch war allzu augenfällig. Er zog meinen Kopf im Schein der Fackel an den Haaren zurück, um ihn von den Dornen zu befreien, sonst hätte ich mir womöglich ein Auge ausgestochen. Indem ich mir lange Kratzer zuzog, schaffte ich es irgendwann, meinen rechten Arm herauszuziehen. Mein Herr sah mich an. Ich befürchtete, er würde mich einfach so zurücklassen. Mein rechtes Bein konnte ich nicht herausziehen, weil es so tief drinsteckte.
Als ich dastand, fand ich keinen Halt. »Bitte hilf mir, Herr«, flehte ich. Mir war nicht daran gelegen, bis zum Morgen in den Sträuchern festzustecken. Es war peinlich, ich konnte nichts tun und hatte große Schmerzen. »Bitte, Herr«, winselte ich. »Hilf mir.«
Nun zog er mich hoch in seine Arme und befreite dabei mein Bein, wenn auch nicht ohne Schnitte und Schürfwunden. In diesem Moment genoss ich es, dass er mich festhielt und mich umarmte. Für ihn schien ich nichts zu wiegen. Seine kräftigen Hände an meinem Körper zu fühlen, gefiel mir, während er mich mit Leichtigkeit hoch über der Erde hielt, die ich, solange er mich trug, nicht berühren konnte, bis er es mir ermöglichte. Nackt wie ich war, traute ich mich, meinen Kopf an die Schulter seiner Tunika zu lehnen. Irgendwann stellte er mich ab. Ich wich seinem Blick aus. Vor ihm fühlte ich mich klein. Dass ich hatte fliehen wollen, war offensichtlich. Zu jener Zeit wusste ich noch nicht, welche Strafe einem Mädchen blüht, das dieses Wagnis eingeht und das Pech hat, wieder eingefangen zu werden, was nahezu immer geschieht. Sklavinnen gelingt so gut wie niemals die Flucht. Der Hauptgrund dafür ist ihr Stahlreif, der ihren Hals hartnäckig umschließt und, so man ihn lesen kann, ihren Herrn sowie dessen Stadt identifiziert. Natürlich käme so gut wie niemand auf die Idee, eine Sklavin ihres Halsreifs zu entledigen, es sei denn, um ihr den eigenen anzulegen. Dies liegt daran, dass sie eben eine Sklavin ist. Außerdem setzt man mitunter abgerichtete Sleens auf sie an, die sich als unermüdliche Jäger erweisen. Entwischt ein Mädchen einem Herrn, wird es zwangsläufig bald einem anderen in die Hände fallen. Eine erfolgreiche Flucht, so selten sie vorkommt, führt aus der Sicht der Sklavin in der Regel zu nichts weiter als einem Tausch ihres Halsreifs und ihrer Ketten. Beinahe jeder Mann auf Gor wird sich beeilen, einer hübschen, frei herumlaufenden Sklavin seinen Reif anzulegen. Wohin soll sie also fliehen? Was kann sie tun? Alles in allem stellt die Flucht keine Option für eine Sklavin dar. Sie ist leibeigen und wird es immer bleiben. Außerdem trägt sie ein Brandmal, das eine Flucht im Grunde genommen praktisch unmöglich macht. Durchstochene Ohrläppchen erschweren es einem Mädchen im Übrigen ebenfalls, sich der Gefangennahme zu entziehen. Vom Standpunkt eines Bewohners der Erde mutete es interessant an, dass die meisten goreanischen Frauen, ob frei oder nicht, diesen Eingriff als schmählicher empfinden als das Brandzeichen. Auf Gor gebürtige Sklavinnen sträuben sich zutiefst davor, weil Ohrlöcher so auffällig sind und durchstochenes Fleisch eine starke erotische Wirkung hat. Welcher Mann würde nur einen Gedanken daran verschwenden, sie freizulassen, wenn sie durchstochene Ohrläppchen hätte? Mädchen flehen ihre Herren an, sie davor zu verschonen, doch diese Bitte wird gemeinhin ignoriert und der Eingriff vorgenommen. Hinterher – dies sollte nicht unerwähnt bleiben – sind sie normalerweise zufrieden mit ihren Ohrlöchern und fangen sogar an, sich etwas auf diese hinzugewonnene erotische Dimension ihrer Schönheit einzubilden. Auch den wunderbaren Schmuck, mit dem sie ihren Körper auf Geheiß des Herrn zieren, verachten sie durchaus nicht. Dass freie Frauen ihre geknechteten Schwestern in vielerlei Hinsicht beneiden, ist kein Geheimnis. Dies betrifft ihre Anmut, ihren Frohsinn und die anziehende Wirkung auf Männer, wodurch sich auch erklärt, weshalb Freie oft ziemlich grausam mit Sklavinnen umspringen. Den meisten Kettenmädchen graut es davor, von einer jener gefürchteten Freien gekauft zu werden. Ich habe mich schon häufig gefragt, ob freie Goreanerinnen nicht vielleicht glücklicher wären, wenn ihnen die Kultur gewährte, ein wenig mehr wie die Sklavinnen zu sein, die sie so inniglich verachten. Ich halte es für eine Kleinigkeit, freien Frauen zu gestatten, sich die Ohrläppchen durchbohren zu lassen, damit sie ihre Ohren mit Ringen schmücken können. Wäre das wirklich zu viel verlangt? Es ist nur die Bindung an althergebrachte Sitten, die so stark ist. Auf der Erde würde einer freien Frau nicht im Traum einfallen, sich brandmarken zu lassen, um sich dadurch zu verschönern und passend dazu wäre einer freien Goreanerin nicht daran gelegen, ihre Ohren durchstechen zu lassen. Unter Sklavinnen auf Gor jedoch ist dieser Brauch weitverbreitet, forciert durch den Willen ihres Herrn. Man kann sagen, er erfreue sich wachsender Beliebtheit unter Männern, woraus sich zwangsweise ergibt, dass der Anteil an Ohrringe tragenden Sklavinnen auf dem Planeten zunimmt. Die Wurzeln dieser Tradition gehen, wie man mir sagte, auf die Stadt Turia auf der Südhalbkugel zurück, ein wichtiges Fertigungs- und Handelszentrum.
Читать дальше