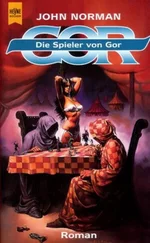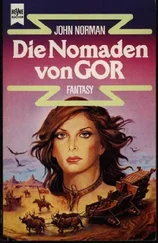John Norman
Die Bestien von Gor
»Es gibt keinerlei Hinweise«, hatte Samos gesagt.
Hellwach lag ich auf der breiten Couch und starrte zur Decke des Zimmers empor. Aus einer durchlöcherten Lampe flackerte schwaches Licht. Die Pelze waren tief und weich. Neben mir lagen die Waffen. Zu meinen Füßen lag angekettet eine Sklavin.
Es gab keinerlei Hinweise.
»Er kann überall sein«, hatte Samos gesagt und die Achseln gezuckt. »Wir wissen nur, daß er sich irgendwo aufhält, mitten unter uns.«
Über jene Spezies, die wir Kurii nennen, ist nur wenig bekannt. Wir wissen, daß ein Kur blutrünstig ist daß er Menschenfleisch frißt und Ruhmestaten im Sinn hat.
»Ein Kur ist dem Menschen nicht unähnlich«, hatte Priesterkönig Minsk einmal zu mir gesagt.
Auf ihre Weise hat diese Geschichte keinen eindeutigen Anfang. Vermutlich hatte sie ihren Ursprung vor mehreren tausend Jahren, als die Kurii in langen Stammeskriegen ihre Heimatwelt unbewohnbar machten. Sie waren aber technisch schon soweit fortgeschritten, daß sie kleine Stahlwelten bauen konnten, die den Planeten in einer Kreisbahn umliefen – jede dieser Welten hatte einen Durchmesser von mehreren Pasangs. Während die Urwelt verbrannte, wandten sich die Überreste einer zerstrittenen Spezies den Jagdgründen der Sterne zu.
Wir wissen nicht, wie lange diese ihre Jagd dauerte, doch uns ist bekannt, daß die Stahlwelten vor langer Zeit das System eines mittelgroßen gelben Sterns in einer Randzone der zahlreichen schimmernden Spiraluniversen erreichten. Und dort harten sie ihr Opfer gefunden, eine Welt.
Sogar zwei Welten – den Planeten Erde und jene andere Welt, die Gor genannt wird.
Eine dieser Welten war im Begriff, sich selbst zu vergiften, eine verrückt gewordene, kurzsichtige Welt, bestimmt von Gier und einem Willen zur Selbstzerstörung. Die andere war eine natürliche Welt, jungfräulich in ihrer Schönheit und Fruchtbarkeit, eine Welt, die nach dem Willen ihrer Herren und Meister, der Sardar oder Priesterkönige, dem Beispiel der unglücklichen Schwester nicht folgen durfte. Die Priesterkönige gestatteten es den Menschen nicht. Gor zu vernichten. Sie sind nicht großzügig, sie lassen Völkermord nicht zu. Darin sind sie vernünftig, und Vernunft kann man an den Tag legen, ohne schwach zu sein. Und die Priesterkönige sind nicht schwach.
»Halb-Ohr ist mitten unter uns«, hatte Samos gesagt.
Ich starrte an die Decke und beobachtete die sich verschiebenden Schatten.
Viele tausend Jahre lang hatten die Priesterkönige das System des gelben Sterns gegen die Pläne der umherziehenden Kurii verteidigt. Dabei hatte das Kriegsglück wohl viele Dutzendmal die Seiten gewechselt, doch war es den Kurii niemals gelungen, an den Küsten dieser wunderschönen Welt einen Brückenkopf zu bilden. Vor einigen Jahren jedoch, zur Zeit des großen Nestkriegs, war die Macht der Priesterkönige erheblich beschnitten gewesen. Ich glaube nicht, daß die Kurii diesen Umstand bereits erkannt haben oder wissen, wie groß dieser Machtverlust wirklich ist.
Wüßten sie die Wahrheit, so würden zwischen den Stahlwelten die Losungsworte gewechselt, die Luken würden sich öffnen, und Schiffe würden Kurs auf Gor nehmen.
Aber der Kur ist ein vorsichtiges Tier, wie der Hai und der Sleen. Er schleicht herum, er wittert in den Wind und schlägt erst zu, wenn er seiner Sache ganz sicher ist.
Samos war beunruhigt darüber, daß sich der hohe Kur mit Namen Halb-Ohr neuerdings auf dieser Welt aufhielt. Diese Information war in einer verschlüsselten Botschaft enthalten gewesen, die in Form eines Halsbands zu uns gekommen war. Daß Halb-Ohr nach Gor gekommen war, stellte für Samos und die Priesterkönige den Beweis dar, daß die Invasion bald stattfinden sollte.
Vielleicht rasten die Schiffe der Kurii bereits auf Gor zu, zielstrebig und lautlos wie Haie im Wasser des dunklen Weltraums.
Aber ich nahm es nicht an. Ich war nicht davon überzeugt, daß die Invasion bevorstand. Vielmehr vermutete ich, daß Halb-Ohr gekommen war, um die Invasion vorzubereiten.
Und daran mußte er gehindert werden.
Wenn er die Schwäche der Priesterkönige entdeckte und es darüber hinaus schaffte, ein Depot für Treibstoff und sichere Wartung der landenden Schiffe zu errichten, gab es wenig Grund für die Annahme, daß die Invasion nicht erfolgreich ablaufen würde.
Halb-Ohr war auf Gor. Daraus war zu schließen, daß die Kurii nun endlich handelten, wohlüberlegt, gefährlich.
Aber wo war er?
Beinahe hätte ich diese Frage ärgerlich ausgerufen, die Hände zu Fäusten geballt.
Die Sklavin zu meinen Füßen bewegte sich, erwachte aber nicht.
Ich stemmte mich auf einen Ellbogen hoch und betrachtete sie. Wie unglaublich schön und anschmiegsam war dieses Wesen, eingerollt in die Pelze, halb bedeckt. Ich zog die weiche Bedeckung fort, um sie ganz zu sehen. Sie bewegte sich, strich ein wenig über das Fell, sie zog die Beine an und bewegte die Hände, als wolle sie die Felle wieder hochziehen, doch die Finger griffen ins Leere; daraufhin zog sie die Beine noch mehr an und kuschelte sich ein. Auf der Welt gibt es wohl nichts Schöneres als eine nackte Sklavin, bekleidet mit einem schweren Eisenkragen mit Kette; diese Kette lief zu einem Ring am Fußende der Liege. Das Mädchen hatte eine helle Haut und dunkles Haar, im Augenblick rötlich beschienen von der schwach brennenden Lampe. Ich fand das Geschöpf unglaublich schön. Und sie gehörte mir. Welcher Mann möchte nicht eine wunderschöne Frau besitzen?
Sie drehte sich halb um und tastete wieder nach den Fellen; ihr wurde kalt. Ich packte sie am Arm, zerrte sie energisch neben mich und warf sie auf den Rücken. Zusammenfahrend öffnete sie die Augen. »Herr!« schrie sie leise. Ich drängte mich zwischen ihre Schenkel und drang in sie ein, nahm sie mit kurzen, kräftigen Stößen. »Herr! Herr!« flüsterte sie und klammerte sich an mir fest. Nach ein paar Minuten war ich mit ihr fertig. »Herr«, flüsterte sie. »Ich liebe dich! Ich liebe dich!« Man nimmt eine Sklavin, wann und wie oft es einem beliebt.
Sie drängte sich an mich, preßte ihre Wange gegen meine Brust. Mit Sex läßt sich eine Sklavin oft so gut lenken wie mit Ketten und einer Peitsche.
»Ich liebe dich«, flüsterte sie.
Das Geschlechtsleben einer Frau ist nach meiner Ansicht ein komplizierteres Phänomen als beim Mann. Wird sie richtig behandelt – und damit meine ich nicht, zuvorkommend und sanft, sondern wie es ihrer Natur entspricht –, dann ist sie dem Sex noch hilfloser ausgeliefert als ein Mann. Eine Frau ist aufwühlender, anhaltender Wonnen fähig, um die man sie beneiden kann. Diese Wonnen lassen sich natürlich durch einen Mann dazu einsetzen, sie zur hilflosen Gefangenen, eben zur Sklavin zu machen. Vielleicht liegt hier ein Grund, warum die freien Frauen sich so energisch dagegen wehren. Die Sklavin hat dagegen keine Möglichkeit sich zu schützen, denn sie ist ihrem Herrn ausgeliefert, der sie behandelt, wie es ihm gefällt, und ihren Willen dabei außer acht lassen kann.
Ich spürte ihre Lippen an meiner Brust.
»Erfreue mich!« gebot ich ihr.
»Ja, Herr«, flüsterte sie und begann meinen Körper zu küssen und zu liebkosen.
Nach einer Weile gebot ich ihr Einhalt und befahl ihr, sich wieder auf den Rücken zu legen.
»Oh«, sagte sie leise, als ich sie von neuem bestieg und in sie eindrang. Mit tränenerfüllten Augen blickte sie zu mir auf. Wie hilflos sie in meinen Armen lag! Ich unterwarf sie dem hinhaltenden Akt einer Sklavinnenerniedrigung, hilflos in den Armen ihres Herrn, der nicht gewillt ist, ihr gegenüber Rücksicht zu zeigen. Ich nahm sie als das, was sie war – als Sklavin.
Nach einer Viertel-Ahn zuckte ihr Körper hilflos, meine Arme bluteten von den Attacken ihrer Fingernägel, ihr Blick war wild. Sie warf den Kopf zurück und schrie zuckend: »Ich bin deine Sklavin! Ich gebe mich dir hin!« Wie schön eine Frau in einem solchen Moment ist! Ich wartete, bis sie sich etwas beruhigt hatte und bebend zu mir aufblickte. Dann schrie auch ich auf vor Lust. Sie klammerte sich an mich und küßte mich. »Ich liebe dich, Herr!« rief sie weinend.
Читать дальше