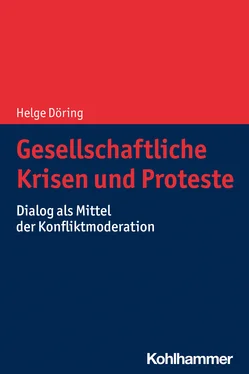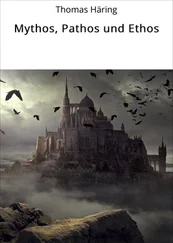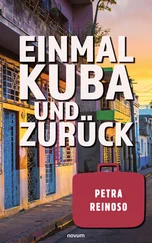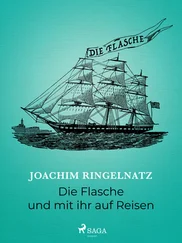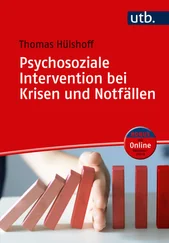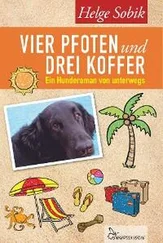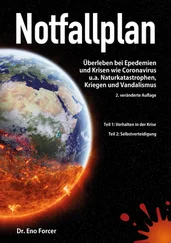»das durch hohe Spontanität, Kreativität, Prozessualität, Selbstreferentialität gekennzeichnet ist. Wenn diskutiert wird, geschieht Gesellschaft in actu. Es ist nicht die statische Ermittlung virtuellen Wissens, sondern die dynamische Beobachtung realer Kommunikation« (ebd. 2011: VI).
4.1 Dialogvoraussetzungen
Dialog setzt von allen Parteien ein hohes Maß an Dialogkompetenz voraus, was bedeutet, dass die Bereitschaft besteht, das Gespräch mit der gegnerischen Fraktion aktiv zu suchen. Wenn unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen, kommt es in der Praxis allerdings nicht selten zu Sprachlosigkeit und Feindschaft (Bolle-Behler 2015). Im weiteren Verlauf führt dies zur Festlegung von Grenzen zwischen den gegnerischen Fraktionen,
»die bei jedem Aufeinandertreffen erneut gezogen, modifiziert oder verfestigt [werden], indem die Kontrahent*innen sich jeweils von ihrer Seite aus und in ihrem Sinne von der anderen Seite abgrenzen und unterscheiden. […] Stoßen jedoch verschiedene Denkordnungen aufeinander, werden aus sachlichen Konflikten und Gegnerschaften schnell Feindschaften, die auf den Anderen selbst zielen. […] Der Gegner wird zum Feind, indem wir nicht mehr nur nein zu dem sagen, was der Andere sagt und tut, sondern zu ihm selbst nein sagen« (Bolle-Behler 2015: 2).
Besonders bei Dauerkrisen kann ein öffentlicher Bürger*innendialog wie ein Katalysator wirken, der einen labilen Burgfrieden beendet und eine Krise erst zur Eskalation führt. Werden die unterschiedlichen Konfliktparteien, die sich bisher mit ihren gegensätzlichen Positionen arrangiert haben, durch provokante Dialogformate gereizt, kann der Konflikt umso intensiver ausbrechen (Hetze 2020: 155). Ein sinnvoller Dialog sollte deshalb darauf gründen, dass auch das eigene Denken stets reflektiert wird und man den Argumenten der Gegenseite folgt und sie als gleichberechtigtes Denken akzeptiert. Dialog erfordert die Bereitschaft und den Mut, sich offen auf ein Gespräch über die Grenzen des eigenen Verständnisses hinweg einzulassen (Bolle-Behler 2015). Die in den Planungsprozess involvierten politischen Entscheidungsträger*innen, betroffenen Bürger*innen und Interessengruppen benötigen dabei große Gelassenheit, eine gute Fähigkeit der Selbstreflexion und vor allem Courage (Renner/Küppers 2017: 8). Damit wird Dialog als ein Ort verstanden, der die Möglichkeit bietet, Konflikten und Differenzen offen zu begegnen und gemeinsam neue Antworten zu finden. Bei einem solchen streitbaren Dialog geht es daher nicht um Konsens, sondern um neue Erkenntnisse und um innovative Denkanstöße für eine sich ändernde Praxis. Die Teilnehmenden des Dialogs begegnen sich auf Augenhöhe und respektieren die Gegenseite, was bedeutet, dass den Anderen höflich begegnet und ihnen zugehört wird, sie ausreden gelassen werden und man sich selbst im Sprechen kurzfasst (ebd. 2015).
Problematisch sind dabei offene,das heißt relativ unmoderierte und thematisch eher oberflächliche Dialogformate, da sie anfällig für demokratiegefährdende Botschaften sind (Glorius et al. 2018). Ohne starke Moderation kann so ein Dialog schnell »entgleiten« und sich in seiner Dynamik aufschaukeln mit nicht intendierten Folgen. 5 Dabei verläuft die Grenzfindung zwischen den Dialogpartner*innen entlang formatbezogenen, thematischen und in letzter Konsequenz gesetzlichen Regelungen, während dies weit weniger klar definiert ist, wenn auf die Wirkung von Dialog abgezielt wird, da auch diese Grenzen hat (Kurtenbach 2019). Demnach ist Dialog
»in erster Linie ein Prozess der kommunikativen Meinungsbildung, des Austausches und streng genommen die Kenntnisnahme einer teils anderen Perspektive und Bewertung zu einem geteilten Interessengegenstand. Dass damit Meinungen oder Einstellungen verändert werden, ist nicht garantiert. Damit ist die Rolle von Dialog in solch krisenhaften Zuständen ambivalent« (Kurtenbach 2019: 193).
Dialog kann einerseits ein Mittel zur Krisenintervention sein, um Eskalationsspiralen zu unterbrechen (Döring/Kurtenbach 2019), und andererseits dazu beitragen, denjenigen Öffentlichkeit zu verschaffen, welche die Grenzen des Sagbaren und in der Konsequenz des Machbaren zu verschieben suchen (Kurtenbach 2019). Im Prozess der Konfliktkonservierung können verschiedene Dialog- und Beteiligungsformate im Zusammenspiel parallel und auch widersprüchlich wirken, sodass ihre Funktionen individuelle und kollektive Schleifen bilden können. Für das erfolgreiche Gelingen von Dialogformaten ist es deshalb zentral, in welcher Phase sich der Aushandlungsprozess befindet und ob der Diskurs fortlaufend begleitet werden soll. In der frühen Phase bieten die Verfahren den Bürger*innen vor allem Hilfe zur Erlangung aller wichtigen Informationen über den Diskurs. Haben sich die Bürger*innen aus ihrer Informiertheit heraus schon eine innere Einstellung gebildet, kann diese durch neue Informationen geprüft, verändert oder revidiert werden (Döring/Kurtenbach 2019:193 ff.). Problematisch wird es, wenn Individuen die Bühne der Dialogarena zur Selbstinszenierung missbrauchen und ihre Extrempositionen verbreiten. Es ist aber durch Moderation möglich, die Teilnehmenden über ihr Mitbestimmungsbedürfnis in die Verantwortung zurückzuholen und wieder eine konstruktive Basis für Dialog zu schaffen.
Durch fortlaufenden konstruktiven Dialog werden nicht alle Probleme gelöst, aber durch den Einsatz der acht Grundregeln für gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung (Brettschneider 2013, S. 322) kann eine Krisenprävention gelingen oder zumindest die Verstetigung von Konflikten und Protesten verhindert werden. Dazu ist es notwendig,
1. frühzeitig und dauerhaft sowie
2. proaktiv zu kommunizieren,
3. den Dialog zu suchen,
4. das eigene Vorhaben und
5. alle komplexen Sachverhalte verständlich zu erklären und
6. dabei anschauliche Geschichten zu erzählen (statt ausschließlich »harter Fakten«),
7. die eigenen Botschaften zu visualisieren und
8. alle Kommunikationsinstrumente darauf abzustimmen.
Durch eine frühzeitige und offene Gestaltung von Dialog, eine konsultative Einbindung akteursspezifischer Interessen sowie eine umfassende Kooperationsbereitschaft der Stakeholder*innen können konfliktschonende Maßnahmen ergriffen werden, um eine effektive Reduktion der Krisenmomente zu realisieren. Dafür ist eine professionelle Vorbereitung, die eine umfassende Umfeld- und Akteur*innenanalyse, eine präzise Zielklärung und die damit verbundene Auswahl des Formats und geeigneter Räumlichkeiten bis hin zur Sitzordnung und Bestuhlung ausmacht, elementar für eine erfolgreiche Veranstaltung. Die Veranstalter*innen vor Ort haben dabei kurz- und längerfristige Ziele zu klären, bei denen es um die Intensität des geführten Dialogs geht, den Einbeziehungsgrad der Bürger*innen in die Thematik und die Frage, ob der Austausch einmalig oder fortlaufend stattfinden soll (Schumacher 2020: 170). Die Betrachtung einer Dialogveranstaltung kann nach Hetze (2020: 144) also folglich nicht erst mit der Versammlung an sich beginnen, sondern muss bereits bei der banal erscheinenden Grundfrage ansetzen, warum die Teilnehmenden darin übereinstimmen, sich an einem bestimmten Ort zur gleichen Zeit zu treffen. Erwarten sie, dass der Austausch mit anderen einen Beitrag zur Erfüllung ihrer spezifischen Bedürfnisse leisten wird? Darauf beruht der Anreiz zur Beteiligung. Folglich wird eine Versammlung kaum besucht, die entweder an den Bedürfnissen vorbeigeht oder nicht glaubhaft die Erwartung auf deren Erfüllung wecken kann (ebd. 2020: 144). Wiederum macht eine Versammlung, die diese Erwartungen komplett enttäuscht, Folgeveranstaltung obsolet, weil die Motivation zur Teilnahme abnimmt. Da aber die Erwartungen sehr unterschiedlich sein können, verkompliziert sich die Frage, um wessen Erwartungen es eigentlich geht und wie man sie gezielt wecken kann (ebd. 2020: 144).
Читать дальше