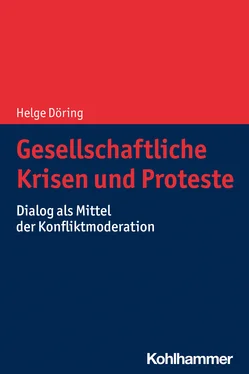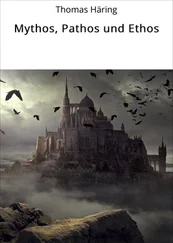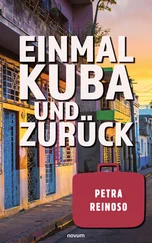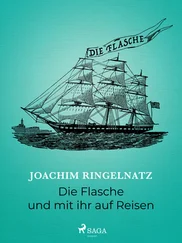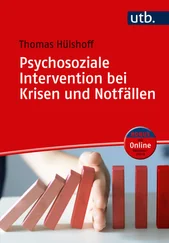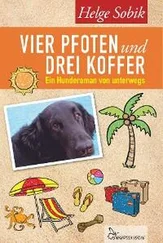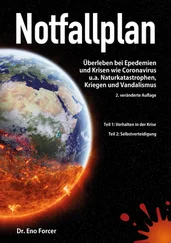• Dialog muss in Bezug auf die vorhandenen Lösungsmöglichkeiten, die bisherige Krisenentwicklung, Konfliktparteien und das einzusetzende Format konzipiert werden.
• Dialogziele müssen formuliert und transparent gemacht werden.
Daraus sind die folgenden Hypothesen abzuleiten, welche durch die Aufarbeitung der verschiedenen Konfliktfälle untersucht werden:
Hypothese 1 – Reeskalation: Wenn Dialog verweigert oder im falschen Format eingesetzt wird, kommt es zur Konfliktverschärfung.
Hypothese 2 – Dauerkrise: Wenn die Vorbedingung realistischer Lösungsmöglichkeiten fehlt, kann Dialog das Konfliktpotenzial nicht vollends reduzieren.
Hypothese 3 – Strukturelle Eskalation: In besonders festgefahren Krisensituationen bleibt Dialog aus oder wird nur indirekt geführt, wodurch er konfliktbelastend wirken kann.
Die Prüfung der Hypothesen bildet zugleich die Beantwortung der forschungsleitenden Frage:
»Wann kann Dialog in Krisensituationen eine Lösung erzeugen?«
Zur Untersuchung der Hypothesen wird jeweils ein Konfliktfall (bei Hypothese 1 sind es zwei Konfliktfälle) aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Ziel ist es, ein besseres Verständnis von Konflikt, Dialog und Eskalation zu erlangen, wodurch Konfliktverläufe besser erklärt werden können. Mit dem so gewonnenen Wissen können zukünftige Dialogverfahren fundiert geplant und die produktive gesellschaftliche Kraft von Konflikten genutzt werden. Die in den folgenden drei Kapiteln untersuchten Konfliktfälle sind:
Kapitel 5 – Konflikte um die Unterbringung Geflüchteter in Dortmund Eving
Im Jahr 2015 sollte im Dortmunder Stadtteil Eving eine Unterkunft für Geflüchtete eröffnen und wie vielerorts in Deutschland gab es in der Nachbarschaft Bedenken oder zumindest Gesprächsbedarf. Dafür wurde von der Stadt Dortmund eine Bürger*innenversammlung einberufen, welche auch rechtsextreme Akteur*innen besuchten, die in Dortmund relativ stark organisiert sind. Nach wiederholten Störungen verwies die Gesprächsleitung die Rechtsextremen des Hauses, woraufhin es vor der Türe zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kam und im Nachhinein zu einigen Mahnwachen der rechten Szene. Bei Konflikten um den Bürger*innendialog der Partei Alternative für Deutschland (AfD) kam es zu tumultartigen Szenen, als Linksextremist*innen im Saal durch laute Unmutsbekundungen alle Dialogversuche der anwesenden Bundestagsabgeordneten zunichtemachten. In beiden Fällen kann von einer Konfliktverschärfung und Reeskalation ausgegangen werden, weil es durch den verhinderten bzw. massiv gestörten Dialog zu einer stärkeren Polarisierung kam.
Kapitel 6 – Konflikte um die armutsgeprägte Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien in die Dortmunder Nordstadt
Seit Ende der 2010er Jahre ist im Bezirk Innenstadt Nord der Stadt Dortmund eine verstärkte und zugleich armutsgeprägte Zuwanderung aus den EU-Mitgliedsstaaten Rumänien und Bulgarien zu verzeichnen. Als EU-Bürger*innen haben Rumän*innen und Bulgar*innen durch das Freizügigkeitsrecht die Möglichkeit, ihren Wohnsitz innerhalb der EU frei zu wählen, was zu einer (temporären) Abwanderung von Armut bedrohter Menschen aus Rumänien und Bulgarien führt. Diese armutsgeprägte, innereuropäische Migration konzentriert sich häufig auf nur wenige Stadtteile in Deutschland, darunter die Dortmunder Nordstadt. Vor Ort führt dies zu Konflikten im Zusammenleben, welche durch Dialogverfahren eingefangen werden, ohne dass es eine strukturelle Lösung gibt. Demnach ist hier von einer Dauerkrise auszugehen.
Kapitel 7 – Konflikte um das Rheinische Braunkohlerevier
Die zahlreichen Proteste im Rheinischen Braunkohlerevier gegen den Tagebau Hambach und Garzweiler II sowie gegen die Abholzung des Hambacher Waldes haben deutschlandweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sie sind eingeflochten in eine breit aufgestellte Protestlandschaft zur Begrenzung des Klimawandels. Unser Fokus liegt hier auf der Protestbewegung »Ende/Gelände«, aber auch andere Akteur*innen kommen zu Wort. Hier wurden vor allem indirekte Dialogrunden, ob nun vor Ort oder in der Kohlekommission der Bundesregierung (Kommission »Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung«), durchgeführt und dennoch kommt es immer wieder zur Eskalation. An diesem Beispiel kann die Eskalation als Folge ausbleibenden Dialogs untersucht werden. Die stattfindenden Dialoge wurden von den Betroffenen aus Reihen der Bürger*inneninitiativen und Klimagruppen als Pseudodialoge angesehen, die keinerlei Veränderung der Ausgangslage gebracht haben. Außerdem wird in Kapitel 8 ein Exkurs gemacht, bei dem gezeigt wird, wie die Debatte um den Klimawandel online geführt wird und sich dort durch Filterblasen und Echokammern aufschaukelt, am Beispiel von einem Twitter-Skandal bekannt als #Möhrengate.
Zu jedem der Konfliktfälle wurde eine eigenständige Teilstudie durchgeführt. Theoretisch gerahmt ist die Analyse aller Teilstudien durch die Konfliktverlaufstypen. Die verwendeten Daten und das genaue empirische Verfahren werden im Rahmen der jeweiligen Teiluntersuchung vorgestellt.
4Als Stakeholder*innen wird eine Person oder eine Gruppe von Personen bezeichnet, die ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines Prozesses oder Projektes hat.
5Ein Beispiel für einen in seiner Intention völlig aus dem Ruder gelaufenen Dialog kann in der WDR Talkshow »Die letzte Instanz« vom 30. November 2020 gesehen werden, als das Thema Rassismus vollkommen unreflektiert von den anwesenden Diskutant*innen, die keinerlei Expertise aufwiesen, aufgearbeitet wurde. https://www1.wdr.de/nachrichten/kritik-die-letzte-instanz-100.html
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.