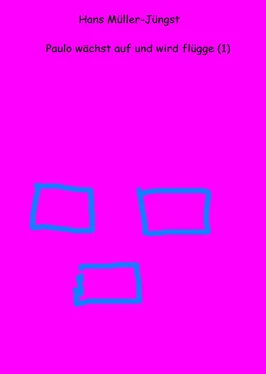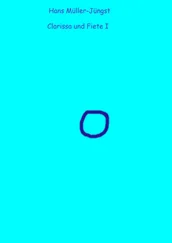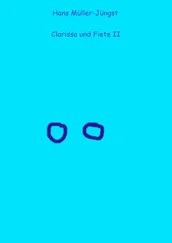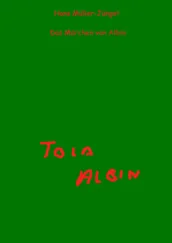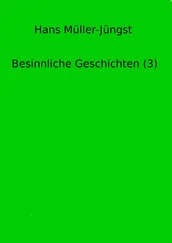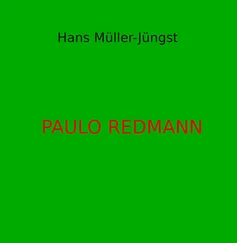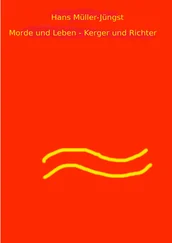Im Vogelpoth waren nach der Schule alle Tische besetzt, so beliebt war die Kneipe.
Ich erinnere mich noch an ein altes Adressbuch, das dort herumlag.
Ein dickes Ding, in dem alle Stadtbewohner mit Adresse, Telefonnummer und Beruf vermerkt waren. Ich glaube, dass es solche Adressbücher aus Datenschutzgründen heute nicht mehr gibt.
Gegenüber dem Haupteingang der Schule lag der Laden von Herrn Storch.
Storch war der Laden für Schüler.
Wenn man ein Heft brauchte, einen Bleistift, ein Radiergummi, einen Pinsel oder einen Block, man bekam hier alles.
Aber Storch hatte natürlich auch Süßigkeiten, wie jeder normale Kiosk.
Und auch das Bier für Agatz´ Geburtstag wurde hier gekauft.
Das Tollste war aber, dass Herr Storch Zigaretten einzeln für zehn Pfennig das Stück verkaufte.
Das wurde natürlich von der Schulleitung nicht gerne gesehen, in den großen Pausen waberten Heerscharen von Schülern von der Raucherecke über die Straße und kauften sich ihre Zigaretten bei Storch.
Etwas weiter hoch Richtung Germaniaplatz gab es einen ganz normalen Kiosk, wir sagten Bude dazu. Hier kauften wir ein Brötchen mit Rollmops oder ein Brötchen mit Rolleschokolade.
Rolleschokolade war eine Art poröse Luftschokolade, die nicht so mächtig war, wie die gewöhnliche Tafelschokolade. Das Stück Rolle mit Brötchen kostete zwanzig Pfennige.
Manchmal reichte das Geld auch noch für eine kleine Cola nach dem Spielturnen.
Zu Haus gab es zu Mittag Dinge zu essen, die man heute nicht mehr auftischt, zumindest wird man Verwunderung auslösen, wenn man Pilzgulasch, Nierchen, Stielmus, Himmel und Erde (gebratene billige Blutwurst mit Apfelmus und Kartoffelpüree) Panhas (das kennt heute kaum noch jemand) oder Hühnersuppe mit Magen und Herz serviert.
Als gymnasiales Großmaul hatte ich natürlich immer was zu meckern, Mutter war dann oft ganz fertig, ich rückte auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht mit der Sprache heraus.
Ziemlich regelmäßig kam gegen vierzehn Uhr Oma hoch.
Sie wohnte im Anbau und hatte mit den Treppen zu kämpfen, die zu uns hoch führten.
Oma war neuapostolisch.
Ich denke, damit hing zusammen, dass sie statt eines Arztes einen Homöopathen aufsuchte, wenn sie gesundheitliche Probleme wie ihre Herzschmerzen therapiert haben musste.
Sie klagte, besonders wenn sie zu uns hereinkam, über Herzschmerzen und ließ sich in den Küchensessel fallen, um auszuruhen.
Wenn dann aber die Skatkarten auf dem Küchentisch lagen und wir zu spielen anfangen wollten, waren alle Herzschmerzen schnell vergessen.
Oma spielte gut Skat und freute sich immer, wenn sie ein Spiel gewonnen hatte („Da haben wir das Ferkel wieder geschlachtet!“).
Wir spielten fast jeden Mittag.
Nach jedem Spiel wurde gezahlt, es ging um einen Zehntel Pfennig, es wurde aufgerundet, ein einfacher Kreuz Solo kostete somit drei Pfennige, ein Grand mit Dreien – der Grand zählte bei uns zwanzig – acht Pfennige.
Kontra und Re verdoppelten jeweils, bei verlorenem Kontra, bei Re, bei einem Spiel ab hundert – zum Beispiel bei einem Grand mit Vierer, bei einem sechziger Spiel („der Arsch hat sich gespalten“) oder bei Schwarz - wurde Bock gespielt. Ramschen gab es bei uns nicht.
Viel Geld gewann oder verlor man so nicht!
Wenn Vater da war, das heißt, wenn er Spätschicht hatte, spielte er kurz auch mit.
Oder wir würfelten, wenn Oma mal nicht da war, das konnte man auch zu zweit.
Entweder wir spielten ein Spiel, das wir „tausend“ nannten oder wir „kniffelten“, dabei musste man immer zuerst die Kniffeltabelle aufzeichnen. Oft gab es einen Einsatz, zum Beispiel zwanzig Pfennige, den der Gewinner bekam.
Mutter trank beim Spielen immer Kaffee, Oma auch, das war das „Näppchen“.
Zum Kaffee wurden „Bärenmarke“ und Zucker genommen.
„Glücksklee“ war verpönt, es musste „Bärenmarke“ sein, der Kaffee war immer „Tschibo“-Kaffee.
Dienstags und freitags war in Borbeck Wochenmarkt (mercado).
Das war eine uralte Einrichtung.
Der Wochenmarkt fand natürlich immer auf dem Marktplatz statt.
Ich erinnere mich an den „billigen Jakob“, der Heftpflaster meterweise verkaufte, der Fischhändler hatte ein Heringsfass, Kieler Sprotten gab es in Spankörben.
Rogen und Milchner wurden verkauft und zu Hause in der Pfanne gebraten, Mutter kannte man schon auf dem Markt, sie ging immer zu denselben Händlern. Oft gab man ihr ein Extra, wie zum Beispiel ein Stück Fleischwurst oder ein paar Äpfel.
Sie fuhr mit ihrem Rad zum Markt, den gleichen Weg, den wir zur Schule nahmen.
Schwer bepackt rollte sie bergab nach Hause.
Sie war stolz darauf, dass sie den Weg bis ins hohe Alter mit dem Rad bewältigte, während andere Frauen den Bus benutzten.
Mutter hatte einen Riecher für Sonderangebote.
Manchmal fuhr sie außer der Reihe mit dem Rad los, um ein Sonderangebot zu kaufen, von dem sie in der Zeitung gelesen hatte.
Sie war äußerst sparsam, sie war nicht geizig.
Auf dem Markt wurde auch die Wurst gekauft, die wir zu Hause vertilgten.
Ich erinnere mich an Zungenwurst, Schwartemagen, grobe geräucherte Leberwurst und an Corned Beef, Fleischwurst gab es immer.
Es ging nichts über ein frisches, noch leicht warmes Brötchen mit guter Butter und Fleischwurst oder frischer Zungenwurst.
Der Begriff gute Butter stammt noch aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, als es keine Butter gab.
Wie ja überhaupt Nahrungsmittelknappheit herrschte.
Ein Stück gutes Fleisch wurde als Delikatesse angesehen.
Verschiedene Wurstsorten galten fast als Luxus.
Ich hatte aber nie Hunger gelitten und konnte mir die Situation, in der viele nach dem Kriege Hunger litten, kaum vorstellen.
Es wurde aber von meinen Eltern manchmal an die Hungerzeit erinnert, wenn wir den Teller nicht leer aßen, wurde gesagt:
„Wir waren früher froh, wenn wir eine Scheibe trockenes Brot hatten“.
Käse war eigentlich auch immer im Kühlschrank. Meist gab es Holländer, das war junger Gouda.
Vater aß aber auch Stinkkäse („Limburger“) und Camembert.
Der Kühlschrank war abschließbar, ich weiß aber nicht, ob wir überhaupt einen Schlüssel hatten.
Wir kauften eigentlich nur ganz selten in der Nachbarschaft ein, so bei „Prenting“, bei „EKU“ schon gar nicht, höchstens, wenn man mal etwas vergessen hatte.
Oder wir Jungen kauften für zehn Pfennig rohes Sauerkraut, das wir mit den Fingern verdrückten. Für Sauerkraut fuhren wir mit unserer Karre auch bis zum Metzger Dicke.
Früher gab es in den Lebensmittelläden Rabattmarken, die man in Markenbücher klebte.
Für ein volles Markenbuch gab es Geld.
Die Rabattmarken entsprachen in ihrem Wert drei Prozent Skonto.
Früh am Morgen brachte Bäcker Goworrek mittwochs und samstags das Brot.
Mutter nahm immer ein Kassler, manchmal einen Stuten, ein Schwarzbrot (Pumpernickel) und samstags ein paar Brötchen.
Die gekaufte Menge wurde in ein Heft eingetragen und am Samstag bezahlt.
Dieser Brauch war sicher aus der Zeit übrig geblieben, als es noch Wochenlöhne gab.
Manchmal stand ich noch beim Anziehen in der Unterhose, wenn Herr Goworrek klopfte und unmittelbar darauf eintrat.
Er trug einen stabilen Karton auf dem Arm, in dem er die Backwaren hatte.
Milch wurde von Willi Winn gebracht.
Er hatte hinter der Gaststätte „Buchmöller“ eine Milchstube. Herr Winn kam mit Pferd und Wagen, er verkaufte in der Anfangszeit die Milch lose.
Dazu hatte er auf seinem Wagen einen Pumpmechanismus, mit dem er die Milch in die mitgebrachten Milchkannen füllte.
Später gab es Glasflaschen mit Aluminiumkappe. Auch Kakao wurde so verkauft.
Man bekam Liter- und Halbliterflaschen. Die Schulen hatten auch Viertelliterflaschen. Der Milchof war „Kutel“, dort wurde die Milch abgefüllt.
Читать дальше