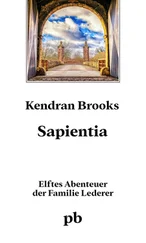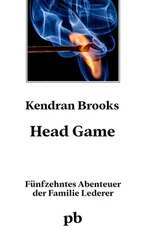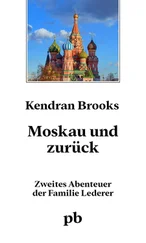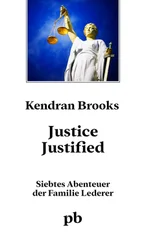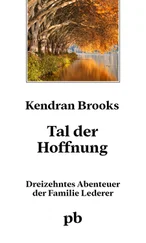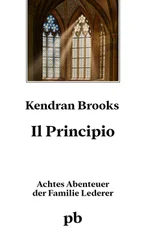*
Jules schrak auf, als Alabima in sein Krankenzimmer trat. Ob er geschlafen hatte, konnte er hinterher nicht einmal sagen. Vielleicht war er nur in tiefen Gedanken gelegen. Doch über was er sinniert haben mochte, wusste er nicht.
»Hallo, Jules. Wie geht es dir heute?«, fragte sie ihn zur Begrüßung warm und mitfühlend.
»Es geht, hallo Labi.«
Sie setzte sich zu ihm auf die Bettkante, drückte ihm kurz einen Kuss auf die Lippen. Doch als sie ihren Oberkörper wiederaufrichten wollte, hielt Jules sie an den Schultern fest und so verschmolzen ihre Lippen und ihre Zungen noch einmal ineinander, beteuerten ihre gegenseitige Liebe.
Als sie sich voneinander lösten, atmeten beide etwas stärker und in Alabimas Gesicht zeigte sich große Freude, in Jules eher eine Bestätigung.
»Wann hast du die nächste Chemo?«, fragte sie ihn routinemäßig.
»Heute Nachmittag. Alina ist im Kindergarten?«
»Wie immer.«
Jules hätte nicht hier in der Uni-Klinik übernachten brauchen, hätte die Therapie problemlos auch ambulant machen können. Doch er entschied sich bewusst fürs richtig Krank sein. Und dazu gehörte ein Zimmer im Hospital. Alabima war sich nicht sicher, ob Jules dies aus Selbstmitleid tat oder aus Rücksicht ihr und Alina gegenüber. Sie sollten ihn nicht die ganze Zeit um sich haben, abgemagert und kahlköpfig, mit geröteten Augen und Mundgeruch, ständiger Übelkeit, alles die Folge der nur schlecht verdauten Chemo. Womöglich dachte der Schweizer aber auch bereits ans Sterben und dass der Trennungsschmerz für seine Tochter weniger groß sein musste, wenn sie ihren Vater einige Monate lang nur noch zwei oder dreimal pro Woche für kurze Stunden sah. Alabima hatte seine Beweggründe nie erfragt, hatte ihm jedoch tief in die Augen geblickt und dort die Antwort wohl gefunden.
»Gehen wir später zusammen essen?«
Jules nickte.
»Heute ist wieder einiges in der Post für dich gewesen. Lust es zu lesen?«
Damit kramte sie ein paar Briefumschläge aus ihrer Kelly-Bag.
Jules schüttelte den Kopf, nahm ihr die Briefumschläge aber aus der Hand und legte sie auf den Beistelltisch neben dem Bett ab, musste sich dazu weit hinüberstrecken. Der Saum seiner Pyjama-Jacke rutschte hoch und Alabima sah einmal mehr, wie dünn er doch geworden war. Von seinem einst muskulösen, vom Training gestählten Körper war nicht mehr viel vorhanden. Abgemagert sah er aus, nicht nur im Gesicht, sondern auch um die Taille. Leise seufzend legte er sich wieder zurück, hatte plötzlich Schweiß auf der Stirn.
»Fühlst du dich müde? Soll ich besser gehen und wir verschieben das Essen?«
Er schüttelte verneinend den Kopf, schämte sich einmal mehr seiner Hilfsbedürftigkeit.
»Nein, bitte bleib.«
Seine Stimme klang rau und war auf einmal belegt. Er räusperte sich und schluckte den Kloß des Versagens so hart hinunter, dass ihn sein Kehlkopf schmerzte. Doch zu seinem Erstaunen ging es ihm hinterher besser. Er fühlte sich wacher, leichter, auch stärker. Selbst Alabima erkannte die plötzliche Veränderung an ihm, wie er in ihrem Gesicht ablesen konnte. Diese Bestätigung freute ihn und er wischte sich mit dem Ärmel die feuchte Stirn und das Gesicht trocken.
Noch war er nicht am Ende, nein, noch nicht. Womöglich stand er sogar erst am Anfang?
Nach Wochen der Lethargie, der Selbstaufgabe, vielleicht auch des Selbstmitleids, spürte er, dass er sich nicht mehr länger den Ärzten und ihrer Kunst ausliefern sollte, dass er damit beginnen musste, wieder selbst für sich zu sorgen.
»Ich zieh mich an«, entschied er. Alabima stand sogleich vom Bett auf und ging zum Schrank, holte seine Straßenkleidung und frische Unterwäsche heraus, legte sie auf die Matratze. Jules streifte die Pyjama-Hose ab, köpfte die Jacke auf. Sein Körper glich den schrecklich ausgemergelten Gestalten auf den Fotos aus den Konzentrationslagern des Zweiten Weltkriegs. Doch seine Augen zeigten ein aufloderndes Feuer, einen neuen Kampfwillen.
»Wir gehen diesmal in der Stadt essen. Ich hab das klinisch-schmeckende Essen hier längst über. Und danach will ich mit den Ärzten reden.«
Alabima fühlte sich wie beschenkt, als sie wenig später mit Jules am Arm durch die Flure schritt. Von der einen oder anderen Krankenschwester wurde das Paar teils neugierig, teils überrascht betrachtet. Die meisten lächelten ihnen zu, waren wohl sehr froh darüber, dass ihr Patient aus Zimmer 308 endlich aus seinem Selbstmitleid erwacht war.
*
Mutobo Suheli kochte innerlich vor Wut.
»Was bildet sich der Kerl eigentlich ein?«, beschwerte er sich bei seiner Frau Erina Kassahun. Das Ehepaar hatte sich zum Mittagessen an den Küchentisch gesetzt und Erina schöpfte ihm geschmortes Gemüse auf den Teller, gab einen großen Löffel Kaninchen-Ragout dazu, stellte ihn vor ihm hin, begann dann den Teller ihrer Tochter Elvira zu füllen.
»Was ist denn jetzt schon wieder passiert?«, fragte sie Mutobo leicht tadelnd. Sie mochte beim Essen keine Sorgen oder Probleme wälzen, war überzeugt davon, dass sich schlechte Gedanken und Gefühle auf den Magen und die Verdauung schlugen.
»Na, dieser Asi bin-Elan. Der Kerl bringt mich jedes Mal in Rage, sobald ich ihn sehe oder auch nur von ihm höre.«
Der neue Imam war erst vor drei Wochen in Hara eingetroffen. Das kleine Dorf am Rande der Danakil-Senke war zwar mehrheitlich von Christen bewohnt. Doch der muslimische Anteil an der Bevölkerung war über die letzten Jahre stark gewachsen. Der Gebetsraum im Gemeindezentrum war zu klein geworden und eine Moschee war gebaut worden, finanziert mit Geldern aus Saudi-Arabien. Sie schickten auch gleich den neuen Imam zu ihnen, einen Salafisten aus Ägypten, wie man unter den Christen munkelte. Mutobo hatte Asi bin-Elan darauf angesprochen. Und auch darauf, ob er eigentlich ebenso wie das Gotteshaus von Saudis bezahlt wurde. Doch der Imam hatte bloß listig gelächelt und gemeint, einzig der Glaube hätte ihn hierher geleitet und selbstverständlich seine große Befürchtung, die Muslimen in Hara und Asgarbo könnten vom rechten Glauben abweichen.
Mutobo Suheli und Erina Kassahun waren bereits vor zehn Jahren hierher nach Hara gekommen, um ein Entwicklungsprojekt aufzubauen und zu betreuen. Sie waren ein Ehepaar und hatten eine Tochter mit Namen Elvira, ein quirliges achtjähriges Mädchen. Der Erfolg im Entwicklungsprojekt stellte sich rasch ein und verschiedene Unternehmen wurden gegründet, schufen immer mehr Arbeitsplätze in der gesamten Region. Ein Bewässerungssystem sorgte zusammen mit ausgesuchten Nutzpflanzen, die auch auf den stark salzhaltigen Böden des Beckens gediehen, für ausreichende Ernährung, lösten die frühere einseitige Agrarwirtschaft der Afar mit ihren Viehherden immer mehr ab. Auch zwei Schulen konnten gegründet werden, ein Krankenhaus und eine Radio-Station. Hara war schon immer ein mehrheitlich christliches Dorf gewesen und auch Mutobo gehörte dieser Religion an, während Erina als Afar wie die meisten anderen Bewohner der Danakil-Senke Muslimin war. Erina war zum Christentum konvertiert, was von vielen Einheimischen skeptisch oder ablehnend betrachtet worden war. Doch die Menschen hatten sich mittlerweile an ein Nebeneinander gewöhnt und andere Paare waren ihrem Beispiel gefolgt, hatten ihrem Herzen und nicht ihrem Glauben den Vorrang gegeben.
Überhaupt fanden die beiden Weltreligionen dank der überaus positiven wirtschaftlichen Entwicklung immer mehr zusammen, empfanden sich seit Jahren nicht mehr als Konkurrenten, sondern als freundschaftlich verbundene Nachbarn. Doch damit schien mit dem Einzug des neuen Imams in das kleine Haus neben der neu gebauten, prächtig anzuschauenden und viel zu großen, ja, protzigen Moschee endgültig Schluss zu sein.
»Er will eine eigene Schule gründen.«
Die Stimme von Mutobo knirschte bei diesem Satz, so sehr presste ihm der Zorn die Kiefer zusammen.
Читать дальше