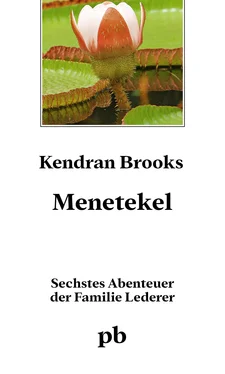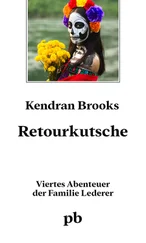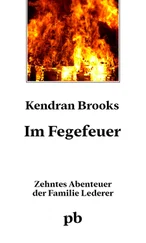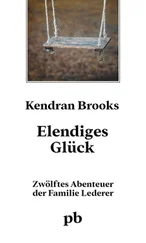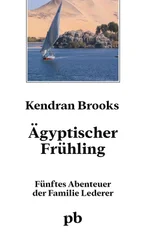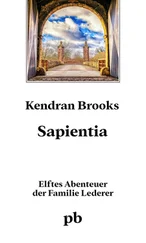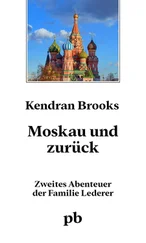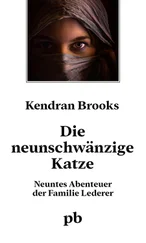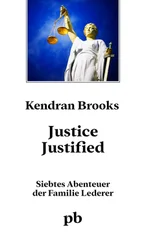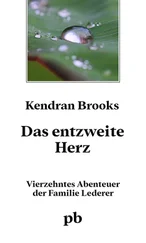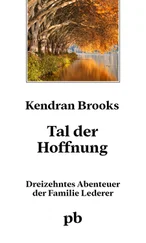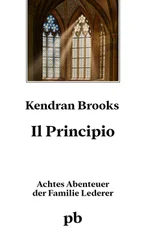Chufu stimmte ihr zu.
»Warum auch nicht? Tun wir etwas für das Überleben der Menschheit«, meinte er gönnerhaft, »irgendjemand muss es ja machen«, fügte er pathetisch hinzu.
Sie riefen die angegebene Nummer an, sprachen mit einer Sachbearbeiterin von Ouro Floresta. Sie erklärte ihnen die Ziele des Projekts mit den ähnlichen Worten, wie sie schon im Intranet der Uni zu lesen waren.
Die brasilianische Regierung plante eine Anzahl von neuen Wasserkraftwerken an den Zuflüssen zum Amazonas. Seit gut einem Jahr war die Energiebehörde des Landes dabei, mögliche Standorte abzuklären, untersuchte dazu vor allem die durchschnittlichen Wassermengen und errechnete daraus die möglichen Stromkapazitäten und Energiemengen. Dass die neuen Dämme riesige Gebiete überschwemmen würden und die dort lebende Flora und Fauna zerstören oder zumindest verdrängen konnte, schien die Regierung nicht weiter zu kümmern. Brasilien brauchte Energie und das Amazons-Becken konnte sie liefern.
Die Schutzorganisation Ouro Floresta plante als Gegenmaßnahme, überall im Lande die bereits bestehenden Listen über die Tier- und Pflanzenwelt des Regenwaldes zu ergänzen. Sie wollten dazu ein Dutzend kleiner Teams im Amazonas-Gebiet installieren. Ein Biologe sollte zusammen mit einigen Volontiere in eines der vom Bau der geplanten Staudämme betroffenen Gebiet reisen und dort nach bislang unbekannten Lebensformen forschen, sie finden und katalogisieren. Die Umweltschutz-Aktivisten wurden dabei von einer Vielzahl ausländischer Organisationen finanziell unterstützt. allein Greenpeace wollte acht Wissenschaftler für dieses Projekt zur Verfügung stellen. Mit den Forschungsergebnissen hofften sie nicht in erster Linie die brasilianische Regierung und das Parlament zu beeinflussen, sondern wollten über Medien vor allem Druck aus dem Ausland aufbauen.
Die Frau am Telefon sprach davon, dass die Mitglieder des Projekts die Reisekosten und sogar ihre Verpflegung und Unterbringung größtenteils selbst übernehmen mussten. Chufu und Mei konnten sie in dieser Hinsicht beruhigen, wurden die beiden doch finanziell überaus großzügig von ihren Familien unterstützt. Ein paar tausend Real konnten sie problemlos in das Abenteuer einer Amazons-Rettung einbringen. Sie vereinbarten für den Nachmittag einen Termin mit der Frau.
*
Die leitenden Ingenieure der Mumbai Construction Ltd. & Cie. hatten am ovalen Sitzungstisch Platz genommen, schauten den Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Bharat Malik, gespannt an. Malik war ein Mann Mitte fünfzig, mit weißem, kurz geschorenen Haar und einem gemütlichen, runden, ins feiste tendierende Gesicht. Seine Augenbrauen war noch tiefschwarz, vielleicht gefärbt, ebenso die langen Wimpern. Die fast schwarzen Pupillen hielten fast jeden Gesprächspartner gefangen, besaßen ein faszinierendes Glitzern, zeigten Interesse und Intelligenz. Er führte das Unternehmen in der zweiten Generation, hatte es zu einem der führenden Ingenieurbüros in der größten Stadt Indiens gemacht.
»Um mich kurz zu fassen, meine Herren, wir haben den Auftrag zum Bau der Schnellstraße für unser Unternehmen gewinnen können.«
Bharat Malik pflegte einen Führungsstil, der sich an westlichen Werten und indischen Traditionen orientierte. Es war die Balance zwischen europäischer Klarheit und heimatlicher Höflichkeit, die den großen Erfolg seiner Unternehmung unterstützte. Und so nahm er den verhaltenen, höflichen Applaus seiner Mitarbeitenden ohne Regung entgegen.
»Noch in dieser Woche werden wir mit den Vermessungsarbeiten beginnen. Wir werden vier Teams in die Region entsenden, denn der exakte Trassenverlauf muss bis Ende Juni stehen, damit die Regierung die notwendigen Käufe und Enteignungen in die Wege leiten kann.«
Es war eine der Besonderheiten Indiens, bei öffentlichen Ausschreibungen von staatlichen Infrastrukturprojekten nur wenige technische Vorgaben und Zwänge zu erlassen. Man agierte eher mit Zielvorgaben, überließ dem anbietenden Unternehmer die Ausarbeitung detaillierter Konzepte für eine möglichst günstige Umsetzung. Der indische Staat verließ sich auf die Wirtschaft mit ihrem immensen Vorstellungsvermögen und ihrem schier grenzenlosen Eifer. Darum gewährte er möglichst viele Freiheiten zur Erreichung der verlangten Ziele, hatte stets auch offene Ohren für unorthodoxe Lösungen. So blieben die Kosten tief und die Lösungen optimierten sich von ganz allein.
Warum sollte auch der Staat auf eigene Kosten die Vorarbeiten leisten, wenn doch die Unternehmen viel flexibler und mit immer neuen Ideen umsonst für ihn arbeiteten?
Im Falle der Schnellstraße bestand die Aufgabenstellung im Bau einer vierspurigen Autobahn zwischen Silchar und Lanka. Sie musste die bisherige Fahrzeit für einen Lastwagen von durchschnittlich sechs Stunden auf unter vier Stunden senken. Und sie durfte höchstens eine Milliarde Rupien, also rund vierzehn Millionen Euro kosten.
Bharat Malik und seine Mumbai Construction hatten sich wochenlang die Gehirne zermartert, ohne wirklich innovative Lösungen zu finden. Die kürzeste Strecke führte durch wild zerklüftete Hügel und entlang von Monsunregen-gefährdeten Berghängen. Tunnel kamen aus Kostengründen jedoch kaum in Frage, Brücken schon eher, doch auch sie nur in minimaler Zahl, angesichts des engen Kostendaches. Auch sollte bei ihrem Konzept so wenig Urwald wie möglich der neuen Straße geopfert werden, denn dies schuf automatisch weitere Pluspunkte bei den verschiedenen Ministerien des Landes. Doch erst die Idee eines erst kürzlich von der Universität als Jahrgangsbester zu ihnen gelangte junge Ingenieurs namens Ramu Bhattacharya hatte sie auf die richtige Fährte gebracht. Er schlug vor, den Gatahawi, einen kleinen Fluss weit oben im Berggebiet, unweit der Ortschaft Mahur anzustauen. Mit einem Damm konnte man die sintflutartigen Regenmassen des Monsuns auffangen und geregelt über das ganze Jahr hinweg an das Tal abgeben. Die zu erwartenden Einnahmen aus der Stromproduktion würden das Zusatzbauwerk finanzieren. Zudem würde der Stausee ein ausgedehntes Sumpfgebiet im Tal unten trockenlegen, was eine kostengünstige Trassenführung erlaubte.
Die Ministerien waren von dieser Idee genauso begeistert, wie zuvor Bharat Malik als Chef der Mumbai Construction, schuf doch der Bau eines Staudamms in der sonst eher strukturarmen, mehrheitlich von Bauern bewohnten Region hunderte von gering qualifizierten Arbeitsstellen, die dem Ausbildungsstand der Landbevölkerung entsprachen. Der anschließende Betrieb der Anlage schuf zudem einige Dutzend gut bezahlter Arbeitsplätze und der Wasserzins aus der Stromproduktion musste zu einer erheblichen Entlastung des öffentlichen Haushalts in der Region führen. Gleichzeitig konnten die Dörfer rund um das Kraftwerk herum kostengünstig elektrifiziert werden, was ein erster Schritt zur Ansiedlung von größeren Gewerbebetrieben war. Denn die Landflucht der armen Bevölkerung konnte man nur durch Dezentralisierung von qualifizierten Arbeitsplätzen verringern, da war man sich in Regierung und Parlament seit langer Zeit einig. Zudem würde man durch das Trockenlegen des Sumpfgebiets viel Kulturland gewinnen, das man aber auch als Standorte für Industrie und Gewerbe verwenden konnte.
In den darauffolgenden Wochen bestimmten vier Vermessungsteams der Mumbai Construction den exakten Verlauf der neuen Schnellstraße. Der junge Ingenieur Ramu Bhattacharya legte währenddessen mit einer weiteren Gruppe die Details zum geplanten Wasserkraftwerk fest. Einige der hinzugezogenen Geologen vom IITM in Madras berieten und unterstützten sie bei der Suche nach dem geeignetsten Standort für die Staumauer, ebenso bei den Berechnungen der Statik und der Kosten.
Das Ministerium für Infrastruktur hatte bereits mit der Suche nach privaten Geldgebern für das Staudammprojekt begonnen. Rasch waren unter den vielen wohlhabenden Industriefamilien des Landes eine genügend große Zahl an Interessierten gefunden. An einer Veranstaltung wurden sie über das Projekt eingehend informiert. Und als wenig später die Kosten- und Ertragsrechnung bekannt wurden, kam das Geld innerhalb weniger Stunden zusammen. Man beschloss die Gründung einer privat-rechtlichen Aktiengesellschaft. Der indische Staat beteiligte sich daran mit dreißig Prozent, während siebzig Prozent bei einigen der reichsten Familien des Landes liegen sollten. Alles schien perfekt zu laufen. Bis zu diesem Mittwochnachmittag.
Читать дальше