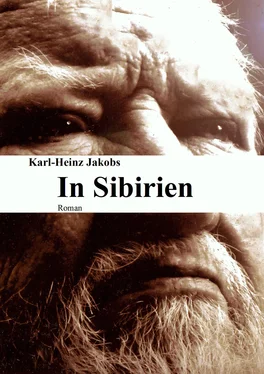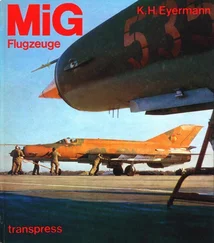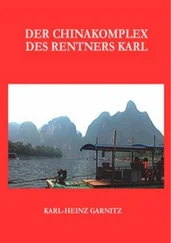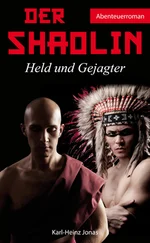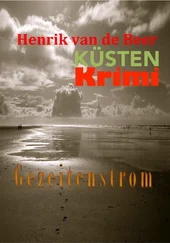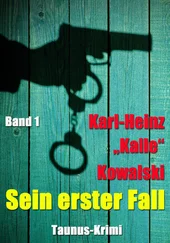„Wie Vatter Nammen?“ wiederholte sie, als Lena mit der Antwort zögerte, denn in Gedanken beschäftigte sie sich mit der Kleidung der beiden Frauen. So eine Lederjacke wollte sie auch tragen, daß sie nicht schon in Deutschland auf den Gedanken gekommen war!
„Namme Vatter! Namme Vatter!“
„August.“
„O, Aw-gust.“
„Nein, Au-gust.“
„O, verrstäh. Aw-gust ... Und Sie verheiratet?“
„Ja.“
„Dann ich Sie grüße Towarischtscha Magdalena Awgustowna.“
Aber man gewöhnt sich an alles, sogar an den Namen des verhaßten Vaters, den sie nun täglich zu hören bekam. Als sie später nach den Gründen fragte, sagte Eva:
„Das ist Rußland. Man ehrt in der Anrede gleichzeitig den Patriarchen des Familienverbandes. Das geht bis in die Zeiten Ruriks zurück ... und ist sehr kompliziert. Am besten, Sie versuchen nicht zu verstehen, wie alles zusammenhängt, sondern passen sich den bestehenden Bedingungen an.“
Sie sollte sich anpassen? Sich anzupassen war gegen ihre Natur, aber was sollte sie tun? Noch einmal gegen Konventionen angehen? Und wohin könnte sie dann fliehen? So kam es, daß sie die Unbegreiflichkeiten in ihrem Gastland nicht zu begreifen versuchte, sondern sich mit der Ausrede zufriedengab: Das ist Rußland. So ist es eben in Rußland. Aber daß sogar zwischen Eva und ihr das Du nicht aufkam, irritierte sie sehr. Erst nach langen Diskussionen hatten sie sich geeinigt, sehr zu Evas Unmut, beim Sie zu bleiben, den Vatersnamen aber wegzulassen.
„Es fällt mir schwer“, hatte Eva gerufen, „Sie nicht mit dem Vatersnamen anzusprechen, das einfache Lena drückt nicht die Hochachtung aus, die ich für Sie empfinde.“
In der Gesellschaftsschicht, in der Eva groß geworden war, gab es keine Kompromisse in dieser Frage, Eva erläuterte es ihr geduldig:
„Die Kinder sagten zur Mutter: Mama, Sie ... , zum Vater: Papa, Sie ...“
Lena hörte es mit Staunen. Die innigsten Freunde pflegten sich mit Sie, mit Vor- und Vaternamen anzusprechen. Nur Betrunkene, Leute aus dem Gesinde, Feuerschlucker, kleine Kinder und Kanalreiniger sprach man mit Du an. Sogar Eva und Lazar, ihr Mann, siezten sich, wie Lena verblüfft beobachtete. So ist es eben in Rußland, hatte Eva es ihr erklärt.
„Auch im ...“, Lena hatte den Satz nicht zuende auszusprechen gewagt.
„Ja, natürlich, auch im Bett“, hatte Eva lachend geantwortet, „allerdings er und seine Mätresse duzen sich.“
„Hat er denn ...?“
„Natürlich hat er eine. Alle führenden Genossen haben eine“, und in Gedanken hatte Lena in ihrem naiven Gemüt für sich hinzugefügt: Das ist Rußland. So ist es eben in Rußland.
Nachdem Eva sie gebeten hatte, hinauszugehen und den geschiedenen Ehemann wegzuschicken, hatte Lena ihn untergehakt:
„Kommen Sie, Lazar Lazarowitsch, gehen wir ein Stück“, und als der Mann rief: „Was wollen Sie von mir? Gehen Sie zum Teufel“, hatte sie ihn gepackt, das zierliche Persönchen mit diplomatischen Geschick, wie Eva dachte: mit der linken Hand den linken Arm des Mannes arretiert, so wie sie es in der Parteigruppe Prenzlauer Berg, Fehrbelliner Straße Ecke Weinbergsweg, geübt hatten, mit der rechten Hand die rechte Schulter des Gegners festgehalten, und nun vorwärts:
„Verduften Sie endlich, Lazar Lazarowitsch, Ihre Frau will nichts von Ihnen wissen. Was sollten die Leute von Ihnen halten, einem so feinen und gebildeten Herrn?“
Sie hat nie erfahren, was wirklich zum Zerwürfnis der Gatten geführt hatte. Eva sprach nie davon. Nur einmal ließ sie eine Bemerkung fallen, über die Lena lange nachdachte. Stalin, sagte sie, gehe zu lasch mit den Konterrevolutionären um. Wenn sie etwas zu sagen hätte, würde sie den ganzen lazarschen Klüngel an die Wand stellen. Und das war nun für Lena ein Problem geworden.
Warten
Lena wurde verhaftet und aus ihrer Wohnung geholt an einem eisigen Januartag.
Kaum hatte Eva sich von Lena verabschiedet, klopfte Alex Gustawowitsch Bellin, der ehemalige Direktor der deutschen Schule an die Tür, auch ein guter Freund, der gekommen war, sie zu beruhigen. Nein, das war kein Leben, das sie führte. Es mußte etwas getan werden. Er hatte die städtische Nervenklinik alarmiert. Nun warteten sie gemeinsam auf die medizinische Betreuerin. Alex Gustawowitsch kannte sich aus in Parteisachen.
„Ach, was, Sie sehen Gespenster. Wovor haben Sie Angst? Was bilden Sie sich ein, wer Sie sind?“
„Moment mal!“ rief sie empört.
„Sie sind eine unbedeutende Lehrerin aus Deutschland. Sie brauchen sich nicht zu fürchten.“
„Moment, Moment ...“, versuchte Lena ihn zu unterbrechen, aber Alex Gustawowitsch ließ sie nicht ausreden:
„Sie brauchen sich nur vorzustellen, Sie lebten in Berlin und müßten Heil Hitler rufen. Ja, meine Liebe, da hieße es Angst zu haben.“
„Zum Donnerwetter“, rief sie, „nun halten Sie endlich die Klappe! Immerhin war ich die Unterweiserin von Obersten und Generalen.“
„Die alle inzwischen brummen, ich weiß.“
„Die meisten sind erschossen“, rief die trotzig, als höbe dieser Umstand die eigene Bedeutung. Sie fanden beide die Bemerkung komisch und lachten.
„Aber worum es geht, das ist Trotzki. Sie sind immun gegen Trotzki. Die Genossen von der GPU wären verrückt, ausgerechnet Sie zu verdächtigen.“
„Nun hören Sie auf mit Ihren Kränkungen. Ich weiß genug, um mitreden zu können.“
„Aha“, sagte Alex Gustawowitsch scheinbar provokativ, um sie zu necken, „das wird die GPU sicher interessieren: Sie wissen also Bescheid über Trotzki?“
„Ohne eine Trotzkistin zu sein!“
„Wovor fürchten Sie sich dann?“
„Ich habe die Tochter von Radek unterrichtet.“
„Na und? Hat sie was begriffen?“
„Nö.“
„Nasehnse.“
Sie lachten beide. Unversehens hatten sie vom Russischen ins Deutsche gewechselt.
„Ein dickes, faules Stück, ich hab sie nur ihres Vaters wegen genommen. Wahrscheinlich war das mein Fehler. Wer konnte auch ahnen ....“
„Daß Radek sich als Radek entpuppt? Wollten Sie das sagen?“
Irgendwann am Nachmittag kam Anton Pawlowitsch, der Zahnarzt.
„Magdalena Awgustowna, verzeihen Sie, ich wollte nur wissen, ob es Ihnen gut geht.“
„Ja, lieber Anton Pawlowitsch, jetzt, da ich Sie sehe, geht es mir wieder gut.“
„Das ist schön, Sie lachen ja wieder, und wenns auch bloß über mich ist.“
Ganz ohne Zweifel war Anton Pawlowitsch verliebt, nur wußte er nicht, es ihr zu sagen.
„Sie müßten mal nach Tula kommen, was meinen Sie wohl, wie dort gelacht wird. Tula ist die lustigste Stadt Russlands“
„Wie kommt das?“
„Wie kommt das? Wie kommt das? Wie kommt das Salz ins Meer? Sie stellen Fragen, die keiner beantworten kann. Wahrscheinlich sind die Tulaer so lustig, weil sie immer gegenüber Moskau ihren eigenen Kopf durchsetzen konnten.“
„Wieso sagen Sie das? Sie leben in Moskau.“
„Moskau, ja, natürlich, das ist die große Welt. Aber Tula, das ist eine völlig andere. Ganz in der Nähe ist Jasnaja Poljana.“
„Jasnaja Poljana!“ rief Lena, „warum sagen Sie das nicht gleich, dann kenne ich Tula, auf dem Weg zum Haus von Tolstoi bin ich durchgefahren.“
„Durchgefahren! Nein, sowas, fährt ohne anzuhalten durch Tula! Nun sagen doch Sie mal ein Wort, Alex Gustawowitsch, ist das nicht unerhört?“
„Doch, doch“, entgegnete der Angesprochene mit kleinem Lächeln, „Tula ist schon eine Reise wert“, und dann ein wenig abschwächend: „Aber, Anton Pawlowitsch, übertreiben Sie nicht ein bißchen?“
Jasnaja Poljana! Lena war gerührt, nach langer Zeit an Jasnaja Poljana erinnert zu werden. Alles, was es zu sehen gab in Rußland, hatte sie mit fliegendem Atem kennengelernt. Das Troizko-Sergijewskaja-Kloster in Sagorsk hatte sie aufgesucht, um Ikone von Rubljow und seinen Schülern im Original zu sehen, hatte mit einer leeren Blechdose in der Hand an der Quelle zur Kathedrale des Heiligen Geistes gestanden, um gesegnetes Wasser zu erhalten, aber nicht, weil sie an Wunder glaubte, sondern weil sie fast zusammengebrochen war in der Schwüle jenes sommerlichen Tages im tiefen Rußland.
Читать дальше