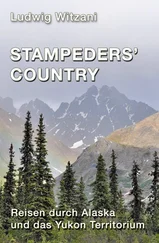Für die Tibeter aber hätten die trostlosen und isolierten chinesischen Stützpunkte im Tsangpotal auch auf dem Mond liegen können, denn sie hatten mit dem Leben der Einheimischen nichts zu tun. Westtibet war Nomadenland, eine Welt der Hirten, die vor allem um drei Zentren kreiste: die Tschörte, das Yak und die Jurte. Tschörten werden dem Reisenden in Tibet begegnen, wo immer er sich auch befand, und auch wir passierten auf unserer Reise nach Westen Hunderte jener großen und kleinen, alten und modernen, prachtvollen, verfallenen oder oft auch nur mit einigen Steinen angedeuteten Gebilden, die wie Elemente einer kuriosen Straßenverkehrsordnung alle Regionen Tibets prägen. Die immer gleich konzipierten, breitbäuchigen und nach oben spitz zulaufenden Bauten erschienen mir vor den fantastischen Kulissen des Tsangpotales mitunter so fremd wie jene berühmte Metallplatte, die am Beginn der Menschheitsgeschichte die Menschenaffen in Stanley Kubricks „Odyssee im Weltall 2001“ verblüffte - und dann wieder wie eine natürliche Ergänzung und humane Überhöhung der Natur durch die Religion. So wie nach der gemeinsamen hinduistisch-buddhistischen Überlieferung die Urgebirge und Urozeane den Urkontinent Jampudiwa umgaben, so wie die Gläubigen in Tibet den heiligen Berg Kailash, die irdische Repräsentation des Weltzentrums, umkreisten, so begriffen die Tibeter die Verehrung und Umrundung der allgegenwärtigen Tschörten als tagtägliche Verankerung ihrer selbst in die harmonische Ganzheit des Universums. Ob sich wirklich in jeder Tschörte, wie Kelsang erklärte, ein heiliger Gegenstand, die Reliquie eines tibetischen Yogis oder gar die Überreste eines Tulkus befand, mochte man glauben oder nicht – auf jeden Fall glichen sie als Schnittpunkte von Immanenz und Transzendenz einem Netz spiritueller Energiespender, die das Leben der Tibeter mehr aufhellten als es jeder Elektrizität vermocht hätte.
Zur harmonischen Ganzheit des Universums gehörte für die Tibeter auch das Yak, die Wollkuh oder der Grunzochse, der in seiner wilden und in seiner domestizierten Variante das Überleben der Tibeter im Tsangpotal sicherte. Das Yak war sensibel und störrisch, hässlich und ergiebig - kurz: nicht nur ein Symbol des Lebens, sondern der größte denkbare irdische Kontrast zur Welt der Tschörten, zwischen denen es seine Weiden fand. Yaks waren lebende Vorratskammer ihrer Hirten, denn es gab praktisch nichts am Yak, was sich nicht im geordneten Haushalt des tibetischen Nomaden verwenden ließe: kein Buttertee ohne das Yak, kein Überleben im Winter ohne das Yakfleisch, keine warme Kleidung ohne das Yakfell, keine Boote ohne Yakhaut - unzählig waren die Möglichkeiten, Haut, Fell, Fleisch, Milch, Sehnen, Innereien und Knochen im Dienste des Hirtenlebens zu verwenden. „Das Yak ist das Gegenteil des Touristen“, scherzte Kelsang. „Der Tourist ist anspruchsvoll und über viertausend Höhenmetern kaum noch zu ertragen“, fuhr sie fort, „das Yak dagegen ist anspruchslos und fühlt sich erst ab einer Höhe von viertausend Höhenmetern so richtig wohl“.
Das dritte Zentrum der Nomadenwelt neben Tschörte und Yak ist die tibetische Jurte, ein überraschend windsicheres, leicht auf- und abbaubares Zelt mit einem warmen Ofen in der Mitte, an dem sich jeder Reisende gerne ein wenig aufwärmte. Schon bei unserem ersten Besuch lernten wir, dass für die Visite in der einer tibetischen Jurte offenbar keinerlei Anmeldung erforderlich war - wer vorbeikam, war willkommen, wenn er nur kein Chinese war und nicht vergaß, zum Abschied ein Gastgeschenk zu hinterlassen, das in etwa dem Wert der Bewirtung, die der Gast erfahren hatte, entsprach. Bei den Nomaden des Tsangpotales schien es sich auch keineswegs um sonderlich arme Familien zu handeln – uigurische Sofas, Holzschränke, kostbare Butterteekannen aus verziertem Holz schmückten das Interieur, und es hätte mich nicht gewundert, in irgendeiner Jurtenecke ein Fernsehgerät mit Satellitenschüssel zu entdecken. Doch so weit war es gottlob noch nicht gekommen, stattdessen flatterten über den Nomadenzelten die Wimpel und Zweige zu Ehren des Buddha im Wind. Wie viel Köpfe jeweils zur Familie zählten, war allerdings auf Anhieb nur schwer abzuschätzen, weil sich - kaum dass wir an einer Jurte gehalten hatten - die Zahl der Kinder und Erwachsenen, die uns staunend betrachteten, exponentiell erhöhte, geradeso als existierte ein geheimes Kuriersystem, das jedweden Besuch von Fremden sogleich in die Nachbarjurten meldete, sodass sich in kürzester Zeit die Einwohnerschaft eines ganzen Tales um den unerwarteten Besuch versammeln konnte. Immer wieder wurden uns Babys in den Schoß gelegt, damit wir uns in Ruhe den Nachwuchs ansehen konnten. Wie üblich bei Kleinkindern in Tibet waren sie fest wie Pakete verschnürt, ohne deswegen zu weinen oder zu greinen, vielmehr blickten sie mit großen staunenden Augen auf die Besucher, ehe sie uns wieder abgenommen, der kleinen Schwester übergeben oder zum Aufwärmen neben den Jurtenofen gelegt wurden.
Obgleich die Bildnisse des Dalai Lama in Tibet nicht mehr gezeigt werden durften, entdeckten wir gleich bei unserem ersten Jurtenbesuch ein großes Portraitfoto des jugendlichen Priesterkönigs auf einem Tisch an der Kopfseite des Zeltes. Topchin, Kelsang und Kunga verbeugten sich vor dem kleinen Altar, um sich gleich anschließend auf bequemen Kissen niederzulassen und vom Tsampa zu kosten, das uns in allen Zelten angeboten wurde. Ich wusste, dass Tsampa, ein sehr trockener aber nahrhafter Mehlbrei ist, den man mit bloßer Hand aus einer Schale isst. Für den verwöhnten europäischen Gaumen ist der erste Tsampagenuss immer ein Schock, mich erinnerte mein erster Kau- und Schluckversuch an ein uraltes Brot, das ich einmal in Kairo gegessen hatte und das ein unredlicher Bäcker mit Sägespänen gestreckt hatte. Auch Frank verzog nach dem ersten Kosten das Gesicht und gab seine Ration an Kunga und Mun weiter.
Die Hausfrau, eine alterslose Nomadin mit einem runden Gesicht und dickgeflochtenen Zöpfen, die ihr die Schulter herabhingen, hatte sich zusammen mit ihrem Mann auf einem großen Kissen niedergelassen. Sie blickte freundlich in die Runde, verscheuchte hin und wieder einige Kinder, die sich allzu vorwitzig vom Zelteingang aus in das Innere vorgewagt hatten und nickte immerfort jedem zu, der etwas sagte.
Auch ich nickte ihr freundlich zu und erkannte, dass sie ein großes Pflaster auf der Wange trug.
„Was ist mit der Frau?“ fragte ich Kelsang. „Hat sie sich verletzt?“
„Kann sein“, antwortete Kelsang. „Vielleicht ist es aber auch nur Show.“
„Show - hier? “ fragte Frank. „Für wen?“
Kelsang blickte noch einmal genauer hin und antwortete: “Wahrscheinlich hat die Frau keine Verletzung. Viele Nomadenfrauen kleben sich Pflaster wie Schmuck auf die Wange. Das sieht dann so aus, als hätten sie gerade einen Arztbesuch hinter sich, und das ist so ziemlich der größte Luxus, den sich ein Nomade am Tsangpo vorstellen kann.“
„Schade, dass wir so wenig Pflaster mitgenommen haben“, meinte Frank trocken. “Sonst könnten wir die Damenwelt rund um den Kailash glücklich machen.“
In einem der zahlreichen Täler, die wir an dritten Tag unser Tsangpo-Reise durchfuhren, befand sich das Kloster Tagelung, in dem vor 1959 immerhin fast fünfzig Mönche gelebt haben sollen, ehe es in den Sechziger Jahren von der chinesischen Besatzungsmacht aufgelöst und zerstört worden war. Erst lange nach dem Ende der Kulturrevolution hatten die überlebenden Mönche zurückkehren und das Kloster mit tatkräftiger Unterstützung der Bewohner des Tsangpotales wieder aufbauen dürfen, sodass es heute wieder, als wäre nichts geschehen, wie eine Festung des Lamaismus am Abhang eines Berges lag.
Читать дальше