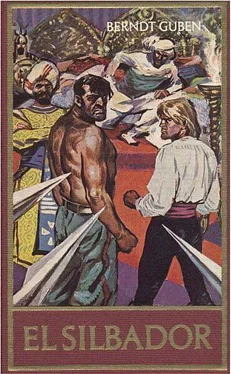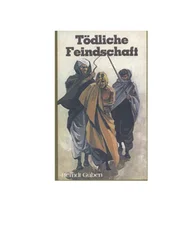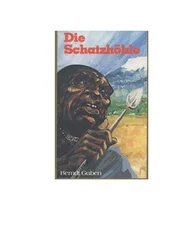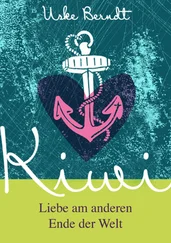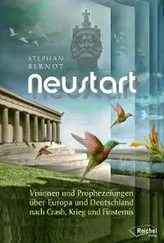Unter solcherlei Gedanken hatte Michel seine eigene Zelle wieder erreicht. Er wollte sich gerade anschicken, den Gang zu verschließen, als von seiner Pritsche her jemand sagte: »Nun, Senor, Ihr wart selbst auf Entdeckungsfahrt, wie ich sehe. Ich nehme an, daß Ihr meine Worte bestätigt gefunden habt. Es führt von hier aus tatsächlich kein Weg in die Freiheit.« »Diablo«, entfuhr es Michel. »Seid Ihr es wirklich, Graf?«
»Natürlich bin ich es. Ich habe Euch doch versprochen, Euch nach Einbruch der Dunkelheit aufzusuchen.«
»Und ich komme soeben aus Eurer Zelle«, meinte Michel verwundert. »So müssen wir aneinander vorbeigegangen sein, ohne daß wir es bemerkt haben. Was haltet Ihr von dem Zustand Pedros?«
Jetzt war es an dem Grafen, erstaunt zu fragen: »Welchen Pedro meint Ihr?«
»Denjenigen, der in Eurer Zelle liegt, den sie heute nachmittag halb zu Tode geprügelt haben.« De Villaverde fuhr auf.
»In meiner Zelle?« fragte er. »In meiner Zelle wohnt außer mir niemand.« »Scherzt nicht, Don Esteban. Ich komme doch direkt von dort und habe den Mann selbst im Fieber sprechen gehört. Ich träume nicht. Dazu erheischt die ganze Situation, in der wir stecken, viel zu sehr unsere ganze Aufmerksamkeit.«
»Santa Maria«, sagte der Graf. »Ich gebe Euch mein Wort, daß sie den Gebundenen nicht zu mir gelegt haben. Die einzige Möglichkeit ist, daß Ihr auf Eurem Erkundungsgang eine Zelle übersprungen habt. Der Gang verbindet vier Zellen. So mögt Ihr in der dritten gewesen sein. Auf welcher Seite des Ganges lag denn der Aufgang, wenn Ihr von hier aus kommt?« »Rechts«, erwiderte Michel.
»Muy bien, der meine führt aber links ab. Nun, es schadet nichts. Jetzt sind wir ja endlich beisammen.«
Bald saßen die beiden nebeneinander auf der Pritsche. Der Graf de Villaverde y Bielsa begann seine Geschichte.
»Es sind vier Jahre her. Da lernte ich in Valadolid die Condesa Marina de Varga kennen. Die de Vargas sind ein altes Adelsgeschlecht, aber seit der Zeit der Inquisition verarmt. Irgendwann einmal muß sich in diese Familie maurisches Blut gemischt haben; denn die Wildheit und Schönheit der de Vargas war nicht allein von spanischer Art. Ich verliebte mich in Marina und erhielt binnen kurzem auch das Jawort ihrer Eltern, obwohl unser Adel jünger ist. Mein Vater warnte mich und flehte mich an, diese Liebe aus meinem Herzen zu reißen. Allein, auch Ihr wißt, Senor, wie unvernünftig die Jugend ist, wenn es sich um Dinge des Gefühls handelt. Wir heirateten. Und ich glaubte zwei Jahre lang, bereits hier unten auf Erden einer überirdischen Seligkeit teilhaftig geworden zu sein. Eines Tages plötzlich erkrankte mein Vater. Es war eigentlich keine richtige Krankheit. Er vergaß auf einmal alles, konnte sich oftmals der einfachsten Dinge nicht mehr erinnern und sank in verhältnismäßig kurzer Zeit in völlige geistige Umnachtung. Kurz zuvor hatten wir Besuch erhalten. Mein Vetter, ein Mann, der mir auf den ersten Blick sehr ähnlich sah, kam, um eine Zeitlang hier zu jagen. Er war ein kühner Jäger und ein kräftiger Mann, dessen geistiger Horizont zwar ein wenig beschränkt, dessen körperliche Vorzüge jedoch die meinen bei weitem in den Schatten stellten. Die Folgen dieses Besuches waren furchtbar. Meine Frau, die früher kein Gewehr angefaßt hatte, entwickelte einen Jagdeifer, den ich mir zunächst nicht zu erklären vermochte. Ich war nicht mißtrauisch. Im Gegenteil, ich gönnte ihr die Abwechslung nur zu gern, denn ich war mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, die mir wenig Zeit ließen, mich um sie zu kümmern. Ihr müßt wissen, daß ich schon seit Jahren mit der Entwicklung eines Gewehrs beschäftigt bin, mit dem man mehrmals hintereinander schießen kann, ohne laden zu müssen. Kurz, bevor ich hier in meinem eigenen Verließ eingesperrt wurde, standen die Vorarbeiten dicht vor dem Abschluß. Das nur nebenbei. — Eines Nachts — ich kam spät aus meinem Arbeitszimmer und mußte an dem Schlafgemach meiner Frau vorbeigehen — hörte ich Stimmen und lautes Lachen. Erstaunt ob der späten Fröhlichkeit, öffnete ich die Tür und fand Marina in den Armen meines Vetters.Beide schienen betrunken zu sein. Fast hätte mich der Schlag getroffen; aber mein Stolz verbot mir, die Fassung zu verlieren. Da die Ehebrecher nicht einmal Notiz von mir nahmen, obwohl ich keine zehn Schritte von ihnen entfernt stand, hielt ich es für das beste, mich zurückzuziehen. Trotz des inneren Wehs entschloß ich mich in der folgenden, schlaflosen Nacht, mein geliebtes Weib aus dem Haus zu werfen. Was blieb mir auch anderes übrig? Nun, es sollte nicht so weit kommen. Gegen Morgen, ich war endlich in einen unruhigen Schlummer gefallen, drangen die beiden in mein Schlafzimmer ein, fesselten und knebelten mich und warfen mich ins Schloßverließ.« Der Graf atmete schwer. Die Erinnerung an jene Nacht drückte ihn nieder und raubte ihm beinahe die Fassung.
»Ja«, stammelte er, »eine solche Teufelin habe ich mir ins Haus geholt, trotz der Warnung meines Vaters. Seit zwei Jahren sitze ich nun in diesem verfluchten Kerker. Und ich habe kaum Hoffnung mehr, jemals wieder hinauszukommen.«
»Und die Dienerschaft?« fragte Michel, »hat sie sich niemals gefragt, wo Ihr geblieben sein könntet?«
Esteban zuckte die Schultern.
»Was ich im Lauf der Jahre aus meinem mürrischen Wärter herausholen konnte, war, daß die alten, treuen Diener kurze Zeit nach meinem Verschwinden samt und sonders entlassen worden sind. Hier auf dem Schloß kennt mich niemand mehr. Und mein Vater war schon zu jener Zeit nicht mehr zurechnungsfähig. Manchmal kommt mir der Gedanke, daß mein Vetter und meine Frau ihn langsam vergifteten, um den Anschein zu wahren, er sei eines natürlichen Todes gestorben.«
Michel dachte nach. Hatte nicht jener Diener, der sich Juan nannte, über den alten Grafen in ziemlich abfälliger Art gesprochen? Hatte er ihn nicht eine willenlose Puppe genannt? Er teilte diese seine Beobachtung dem Grafen mit. Dieser nickte nur trübsinnig.
»Das habe ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich ist er heute so weit, daß er den falschen gar nicht mehr vom echten Sohn unterscheiden kann. Vielleicht hat er gar unter dem Einfluß meines Vetters ein Testament zu dessen Gunsten gemacht. So könnte Fernando, das ist der richtige Name meines Vetters, gar noch auf rechtliche, unanfechtbare Weise nach dem Tode meines Vaters in den Besitz des Schlosses kommen. Villaverde ist so abgelegen, daß sich kaum ein Mensch jemals um die Zustände hier kümmern würde. Zudem ist das Schloß kein Lehen, sondern uralter, einstmals käuflich erworbener Familienbesitz.«. Michel stand auf und schritt in der Zelle auf und ab.
»Wenn es mir gelänge, hier herauszukommen, so würde ich Euch bald zu Euerm Recht verholfen haben, Graf«, sagte er. Esteban lachte bitter auf.
»Es gibt keine Möglichkeit einer Flucht. Ich kenne die Gänge, die unter dem Schloß entlangführen, ganz genau. Ja, wenn wir die Wand der vierten Zelle durchbrechen könnten! Dort
führt ein Gang vorbei, der im Gebirge — weit draußen — endet. Doch sind die Felsmauern mindestens zwei Meter dick. Und wir haben nichts als unsere Fingernägel zum Durchbrechen des Gesteins. Weiß Gott, ein unzureichenderes Werkzeug gibt es nicht.«
Michel begann plötzlich, ganz in Gedanken, laut zu pfeifen. Es war eine Stelle aus der kleinen g-Moll-Fuge von Johann Sebastian Bach, die ihm noch vom letzten königlichen Konzert in Berlin her im Gedächtnis geblieben war. Der Graf erschrak zuerst, hörte dann aber andächtig zu.
Michel brach ebenso plötzlich ab, wie er begonnen hatte; denn es wurde ihm bewußt, daß er sich einer Unhöflichkeit dem Gast gegenüber schuldig gemacht hatte.
»Verzeiht, Don Esteban ... manchmal kommt es so über mich. Dann muß ich pfeifen. Es hat mir schon in vielen Situationen geholfen.« Esteban meinte verwundert:
Читать дальше