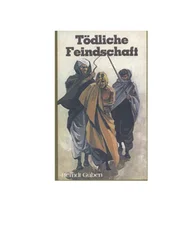1
Immer dunkler wurde die Nacht über der Muskatnußinsel. Nichts war zu spüren von der sprichwörtlichen Süße südlicher Nächte. Dicke Wolkenfelder verdüsterten den Himmel und ließen das Licht der Sterne verlöschen.
Die Männer, die Stunden zuvor jubelnd an Land gesprungen waren, sich im Fluß getummelt und gebadet hatten, die Ströme von frischem Süßwasser lachend über die durstige Zunge geschüttet hatten, lagen jetzt in den wilden Muskatnußplantagen und schliefen einen erquickenden Schlaf.
Die am Ufer vertäuten Schiffe waren von Mannschaften fast völlig verlassen. Auch die Kapitäne, Steuerleute, Offiziere und Maate, ja, sogar der Pfeifer, Marina, Ojo und Tscham hatten es vorgezogen, in der frischen Luft an Land zu nächtigen. Weit verstreut lagen sie im Gras unter den Bäumen, die jene kostbaren Früchte trugen, mit deren Ernte sie morgen beginnen wollten.
Die ständige Überanstrengung der letzten Tage machte sich besonders bei Michel Baum bemerkbar. Sein Schlaf glich schon eher dem Zustand der Bewußtlosigkeit. Anders bei Mutatulli. Der feine Instinkt der Eingeborenen ließ ihn im Unterbewußtsein alles wahrnehmen, was um ihn herum vorging. Mehr noch, er hatte ein feines Gefühl für die Dinge, ein Ahnungsvermögen sozusagen, das Strömungen registrierte, schon dann, ehe noch Tatsächliches vorging.
So auch in dieser Nacht.Mutatulli erwachte. Seine großen Augen waren weit geöffnet wie die einer Katze, die in der Dunkelheit auf Mäusefang geht. Langsam richtete er sich auf, wandte den Kopf und lauschte. Als er nichts Verdächtiges vernahm, legte er sich ebenso langsam wieder nieder und schloß die Augen. Aber er fand keine Ruhe mehr. Es mußte etwas da sein, eine unbekannte, vielleicht nur ferne Gefahr, die sein Gehirn beunruhigte.
Ein paar hundert Schritte von ihm entfernt lagen Fernando de Navarra und Ernesto, der Maat.
Ernesto schnarchte laut. Und dieses Schnarchen war das erste, was seinen Kameraden aus der Ruhe brachte.
»He, hombre, leg dich auf die Seite«, schimpfte Fernando wütend, »oder willst du die ganze Plantage gleich umsägen?«
»Aahrrr«, machte Ernesto statt aller Antwort. Erst ein Stoß in die Rippen konnte ihn dazu bewegen, seine Lage zu ändern.
Nun waren nur noch seine leisen Atemzüge zu hören. Fernando verschränkte die Arme unter dem Kopf und starrte in den dunklen Himmel. Er gehörte zu den nervösen, intelligenten Wesen, die ohne ein gewisses Maß an Nervenunruhe nicht auskommen können. Einmal im Schlaf gestört, fiel ihm das Wiedereinschlafen sehr schwer. In nicht allzu weiter Entfernung von ihm lag zwischen den Baumstämmen ein ausgedehntes Gebüsch. Von dorther vermeinte er Geräusche zu vernehmen. Manchmal das Knacken von Zweigen. Und dann wieder, fast unhörbar, ein Raunen menschlicher Stimmen. Auf einmal ein unterdrücktes Husten.
Er richtete sich nicht ruckartig auf. Er wandte sich vielmehr völlig geräuschlos um, bis er auf dem Bauch lag.
Mit scharfen, in die Dunkelheit gerichteten Augen arbeitete er sich Schritt um Schritt voran.
Unter Ausnutzung jeglichen Baumschattens gelangte er schließlich zum Ziel seiner Anstrengung. Nun schob er sich in das Gebüsch hinein. Als ihn Zweige und Blätter nach allen Seiten hin deckten, als sein Atem sich beruhigt hatte, als das Rauschen des eigenen Blutes nicht mehr das Hören hinderte, strengte er alle Sinne an.
Sein Bemühen war von Erfolg gekrönt.
Jetzt hörte er es deutlich: Atemzüge, das Knacken von Zweigen, wisperndes Geräusch in unmittelbarer Nähe. Aber aus diesem Wispern schälten sich Laute, die er nicht verstand, menschliche Laute zwar, aber Worte einer fremden, einer eigenartigen gutturalen Sprache.
Eingeborene! ging es ihm durch den Sinn. Die Insel schien demnach bewohnt zu sein. Eine Gänsehaut überlief ihn. Wenn diese Burschen nun auf der Lauer lagen, um die schlafenden Kameraden im geeigneten Augenblick zu überfallen und zu massakrieren?
Schweißperlen traten auf Fernandos Stirn. Er mußte sich ebenso leise zurückziehen, wie er gekommen war. Er mußte die anderen warnen.
Aber seine Hände flogen. Die Spannung in ihm wurde unerträglich. Das Geräusch seines Atems verstärkte sich. Das Rauschen des eigenen Blutes war wieder in seinen Ohren.
Sollte er schreien, einfach Alarm geben? Würden dann die Eingeborenen nicht über die noch Schlaftrunkenen herfallen?
Fernando war unschlüssig. Er kaute an seiner Unterlippe. Er hatte Angst. Was galt schon die eigene Angst, wenn es hieß, die Freunde zu warnen!Er raffte sich auf. Aber die Ausführung seines Entschlusses kam zu spät. Irgendein Gegenstand, eine Keule wahrscheinlich oder ein Stein, traf seinen Kopf. Ihm schwand die Besinnung. Mehrere dunkle Gestalten stürzten sich lautlos wie Schlangen über ihn, zerrten ihn nach der entgegengesetzten Richtung aus dem Gebüsch und verschwanden mit ihm in der Dunkelheit.
Der dumpfe Schlag auf Fernandos Kopf war es, der Mutatulli hell wach werden ließ. Mutatulli überlegte nicht lange. Gleichgültig, ob Menschen diesen Schlag verursacht hatten oder Dämonen, der Schlag an sich gab Anlaß zur Besorgnis.
Der Häuptling erhob sich und wandte sich mit leisen Schritten dorthin, wo der Pfeifer schlief.
»Hallo, Sir«, rüttelte er ihn am Arm. »Hallo, wacht auf!«
Michel Baum hob mit Anstrengung die schweren Lider.
»Was ist? Was wollt Ihr?«
»Dort vorn, in dem dunklen Gebüsch, hat es einen Schlag gegeben. Es sind wahrscheinlich Menschen dort oder waren zumindest dort. Wir sollten nachsehen.«
»Es wird eine heruntergefallene Kokosnuß gewesen sein«, entgegnete Michel schläfrig.
»Nein, Sir, es klang wie der Schlag einer Keule auf das Haupt eines Menschen.« »Seid Ihr sicher?«
»Ganz sicher. Ich werde nachsehen, was es gegeben hat, und den Schäferhund mitnehmen. Ich wollte Euch nur davon unterrichten, damit Ihr mich morgen nicht vergebens sucht.«
»Glaubt Ihr wirklich, daß Fremde hier sind?«
»Wir werden ja sehen. Ich werde mich überzeugen.« Er griff nach seinem Schäferhund. Karo, der ein wenig abseits lag, spitzte die Ohren und sprang dann herzu. Ehe Michel noch etwas erwidern konnte, waren die beiden gegangen.
2
Tunatatschi stand auf dem Steg, der über das Wasser zu seinem Haus führte, als ihm jemand zurief:
»Wir haben einen Gefangenen, Tunatatschi ! Sollen wir ihn zu dir bringen?«
Tunatatschi hob die Hand. In diesem Augenblick durchbrach der Mond die Wolken. Die Handbewegung war von der Stelle, an der die Eingeborenen mit dem gefangenen und besinnungslosen Fernando standen, gut zu sehen. Und so konnte sich der gefürchtete Häuptling der unbekannten Insel einen wörtlichen Befehl sparen.
Der Strahl des Mondes spiegelte sich in einem glasklaren See. Dieser See war der Mittelpunkt der Insel. Hier entsprangen außer dem Fluß, in den die Schiffe der kleinen Flottille eingefahren waren, noch mehrere andere Flüsse, die sich sternförmig über das ziemlich große Eiland verbreiteten.
Lange Stege aus Bambusrohr und Rotang liefen bis tief in den See hinein. Häuser oder Hütten aus dem gleichen Material, auf Pfählen stehend, bildeten die Residenz Tunatatschis und die einzige Stadt.
Sie war ganz auf Pfählen erbaut. Man konnte die Hütten entweder mit einem Baumrindenkanu oder über dieStege erreichen. Das Ganze bot ein seltsam bezauberndes Bild.
Die Eingeborenen, die Fernando de Navarra trugen, gingen sicheren Schrittes über den Steg und legten ihre menschliche Last vor dem Haus ihres Fürsten nieder.
»Wo?« war alles, was Tunatatschi mit unbeweglichen Lippen fragte.
»Drüben, am Ufer des großen Flusses.«
»Wieviel?«
»Vielleicht zehnmal zehn und fünfmal zehn. Sie haben drei Schiffe.«
Er machte eine Handbewegung, die besagte, daß sie den Gefangenen in seine Hütte bringen sollten. Schweigend gehorchten sie dem Befehl. Sie legten Fernando auf eine aus Palmenblättern geflochtene Matte, und entfernten sich schweigend.
Читать дальше