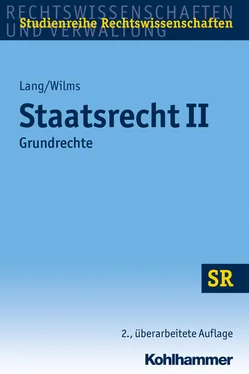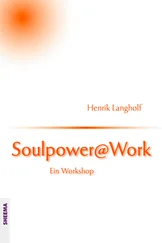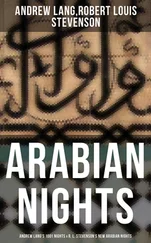1 ...6 7 8 10 11 12 ...44 44 Die Erklärung der Menschenrechte wurde in die französische Verfassung vom 3.9.1791 aufgenommen , die zudem noch weitere „natürliche und bürgerliche Rechte, wie Freizügigkeit, Versammlungs- und Meinungsfreiheit“ enthielt, 40doch wurde diese bereits am 10.8.1792 wieder suspendiert . Nach der Abschaffung der Monarchie am 21.9.1792 mündete die Revolution allmählich in den Terror. Die neue Verfassung vom 24.6.1793 enthielt zwar eine noch ausführlichere Menschenrechtserklärung; in ihr waren auch soziale Rechte, wie die freie Berufswahl, das Recht auf Arbeit sowie Unterstützung bei Arbeitsunfähigkeit und Anspruch auf Unterricht enthalten; sie trat aber nie in Kraft. Die Terrorherrschaft nahm ihren bekannten Lauf. 41
1795 folgte eine weitere Verfassung, in der den Menschenrechten erstmals die Funktion zukam, die nunmehr etablierte bürgerliche Ordnung zu legitimieren. Diese Verfassung wurde bereits 1799 durch die Konsulatsverfassung , welche die Deklaration der Menschenrechte gar nicht erst aufnahm, wieder abgelöst. Die Napoleonische Verfassung von 1804 befasste sich nicht mehr mit Grundrechten. In der Charte Constitutionelle von 1814 waren Teile der Menschen- und Bürgerrechtserklärung enthalten.
In der Französischen Verfassung von 1958 wird auf die Grundrechte der Menschen- und Bürgerrechtserklärung von 1789 verwiesen. Sie sind damit geltendes Verfassungsrecht. 42
VI.Die Entwicklung in Deutschland
Literatur:
Berber, F., Das Staatsideal im Wandel der Weltgeschichte, 2. Aufl. 1978 ; Böckenförde, E.-W., Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie, 2002 ; Gusy, C. , Die Grundrechte in der Weimarer Republik, Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte 1993, 163; Hartung, F./Commichau, G./Murphy, R. , Die Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte von 1776 bis zur Gegenwart, 6. Aufl. 1997; Hofmann, H. , Zur Herkunft der Menschenrechtserklärungen, JuS 1988, 841; ders. , Die Grundrechte 1789–1949–1989, NJW 1989, 3177; Klippel, D., Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jahrhunderts, 1976; Kriele, M. , Zur Geschichte der Grund- und Menschenrechte, FS Scupin, 1973, S. 187; Kühne, J.-D., Die Reichsverfassung der Paulskirche, 2. Aufl., 1998; Kröger, K. , Grundrechtsentwicklung in Deutschland – von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, 1998; Kukk, A. , Verfassungsgeschichtliche Aspekte zum Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit, 2000; Link, Chr. , Menschenrechte und bürgerliche Freiheit, FS Geiger, 1974, S. 277; Oestreich, G., Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss, 2. Aufl. 1978; ders. , Die Idee der Menschenrechte in ihrer geschichtlichen Entwicklung; Perry, R./Cooper, J. C. , The Sources of our Liberties, Chicago, 1978; Pieroth, B. , Geschichte der Grundrechte, Jura 1984, 568; Stourzh, G. , Die Konstitutionalisierung der Individualrechte, JZ 1976, 397.
45Häufig wird darauf hingewiesen, dass die Geschichte der Grundrechte in Deutschland im Vergleich zu England, Frankreich und anderen Ländern mit einiger Verspätung beginne. 43Dies entspricht insoweit den Tatsachen, als man die Geschichte der Grundrechte als eine von Verfassungsurkunden abhängige Geschichte ansehen will. Dies ist allerdings eine stark verkürzte Sichtweise.
46 Aus ideengeschichtlicher Sicht ist der deutsche Beitrag zur Grundrechtsgeschichte beachtlich. Die europäische Naturrechtstradition, die die Idee eines vom Staat und schließlich sogar vom Glauben unabhängigen Rechtsdenkens formuliert hat, ist neben der spanischen Spätscholastik und dem holländischen Rechtsdenker Hugo Grotius eine in großen Teilen deutsche Entwicklung. Für die Formulierung dieser naturrechtlichen Ansätze sind vor allem Samuel Pufendorf (1632–1694), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), Christian Thomasius (1655–1728) und Christian Wolff (1679–1754) zu nennen. 44Das Naturrecht des späten Mittelalters gipfelte schließlich in der Aufklärung und fand in der transzendentalphilosophischen Fundierung der Philosophie und damit auch der Ethik und des Rechtsdenkens bei Immanuel Kant seinen Höhepunkt. Der Begriff der Menschenwürde entstammt letztlich dieser geistigen Tradition und führte die Idee der Grund- und Menschenrechte zu einer neuen Dimension.
47Zutreffend an der Einschätzung der deutschen Geschichte ist weiterhin, dass die Zahl der den Fürsten abgetrotzten Rechtsgarantien in Form von verbrieften Verfassungsurkunden im Vergleich zu England gering ist. Solche „Freiheitsrechte“, die seit dem hohen Mittelalter in Form von schriftlichen Zusicherungen zwischen Fürst und Ständen – d. h. dem hohen Adel, der Ritterschaft, der Geistlichkeit, manchmal auch der Bauernschaft – festgelegt wurden, hatten das Ziel, die Gewalt des Fürsten zu begrenzen. Ein Beispiel hierfür ist der Tübinger Vertrag von 1514 , in dem der politisch gescheiterte Fürst seinen Ständen gewisse Rechte einräumte, etwa die Freiheit der Auswanderung und das Recht zum Widerstand, falls die monarchische Gewalt gegen den Vertrag verstieß. 45
Eine wesentliche Bestimmung des Vertrages war die Klausel, dass niemand in Sachen, „wo es Ehre, Leib und Leben betrifft, anders als mit Urteil und Recht gestraft oder getötet, sondern einem jeden nach seinem Verschulden Recht gestattet werden solle“. 46 Diese Rechte betrafen jedoch nur den Adel , die einzige Gesellschaftsschicht, die „frei“ war, während die anderen Schichten in einem abgestuften Schutz- und Dienstverhältnis zum Adel standen. Unter Freiheit wurde in diesem Zusammenhang eine Privilegierung verstanden, in der sich die Herrschaft konkretisierte. 47
48Mittelalterliche Vorläufer der neuzeitlichen Verfassungen waren die „ leges fundamentales “. Diese Rechtsnormen, die meist in Urkunden niedergelegt wurden, behandelten grundlegende Fragen der Organisation des Reiches, insbesondere zur Begrenzung der Herrschaft des Kaisers oder Königs oder zu den Rechten der Stände. Der jeweilige Herrscher war an die leges fundamentales gebunden und konnte sie nicht einseitig abändern. Beispiele hierfür sind das Wormser Konkordat von 1122, die Goldene Bulle von 1356, in der die Königswahl und besondere Vorrechte der Kurfürsten festgelegt wurden, sowie die Reichsreformgesetze Maximilian I. von 1495 .
49Die eigentliche, als Begrenzung der staatlichen Gewalt verstandene Manifestierung von Grundrechten beginnt im deutschsprachigen Raum am Ende des 18. Jahrhunderts.
Im Unterschied zu Frankreich und Nordamerika wurden grundrechtliche Positionen zunächst nicht von der Basis des Volkes her durchgesetzt . Sie waren vielmehr Produkte aufgeklärter Fürsten , wie z. B. Friedrichs des Großen oder Josephs II. von Österreich.
So enthielt der Entwurf zum Allgemeinen Gesetzbuch für die Preußischen Staaten von 1791 in seiner Einleitung Bestimmungen über das Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern. § 79 EinlPrAGB lautet:
„Die Gesetze und Verordnungen des Staates dürfen die natürliche Freyheit und Rechte der Bürger nicht weiter einschränken, als es der gemeinschaftliche Endzweck erfordert.“
50In dem Abschnitt „Von den Quellen des Rechts“ finden sich weitere Regelungen, die das grundsätzliche Verhältnis des preußischen Staatsdenkens zu den Menschenrechten beleuchten:
§ 90: Die allgemeinen Rechte des Menschen begründen sich auf die natürliche Freyheit, sein eigenes Wohl, ohne Kränkung der Rechte eines Andern, suchen und befördern zu können.
§ 92: Rechte und Pflichten, welche aus Handlungen oder Begebenheiten entspringen, werden allein durch die Gesetze bestimmt.
Читать дальше