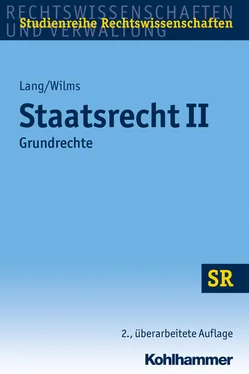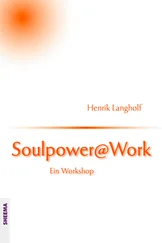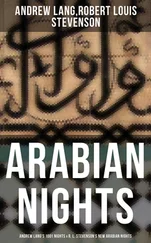19Die Magna Charta wurde von den Baronen und dem Klerus dem englischen König Johann (1199–1216, genannt Ohneland) abgetrotzt und enthielt in nur ganz geringfügigem Umfang Rechtsverbürgungen, zumal diese sich mehr auf die Garantien der Privilegien des Adels richteten und vor allem in keinem einzigen Punkt allgemeine Rechtsgleichheit gewährleisteten. 14Immerhin enthielt sie Gewährleistungen für den Adel, die Einfluss auf die spätere Rechtsentwicklung haben sollten. So garantierte der König in Abschnitt 39 der Magna Charta, dass er keinen freien Mann gefangen nehmen oder des Landes verweisen oder verfolgen werde, außer aufgrund rechtmäßigen Urteils seiner Standesgenossen oder auf Grund des Landesrechts. 15Freie Männer, also „Freiherren“, waren nach mittelalterlichem Rechtsverständnis nur Adlige. Schließlich durften die Steuern nur mit Zustimmung des Adels erhoben werden. Der König verpflichtete sich, diese Rechte zu achten und zu halten. Bei einer Verletzung dieser Rechte sollten die Barone die Untertanen zum Widerstand anführen.
20Trotz ihrer nur beschränkten Rechtsgeltung fand die Magna Charta über das common law Einzug in das allgemeingültige Recht Englands.
21Es gibt weitere Beispiele für ähnliche Rechtsgewährleistungen in Europa , neben den erwähnten Freiheitsbriefen der Cortes von Léon gibt es Charten aus Dänemark (1282), Belgien (1316), Tirol (1342), die „Joyeuse Entrée“ in Brabant (1356) und Tübingen (1514). 16In diesen Urkunden kommt der Gedanke der Beschränkung der Herrschaftsgewalt durch objektives staatliches Recht zum Ausdruck. 17
Diese Erklärungen sind als sog. Herrschaftsverträge zu verstehen, in welchen der Herrscher mit den Ständen einen Vertrag über die Bedingungen seiner Herrschaft schließt. Die darin enthaltenen Rechte sind objektiven Charakters, die nicht individuell, sondern korporativ gewährt wurden. 18
22Rechtsverbürgungen, die dem heutigen Grundrechtscharakter weit näher kommen, haben sich erst in späteren Jahrhunderten, zunächst in England, später auch auf dem Kontinent, entwickelt.
III.Die Entwicklung in England
23Auch nach der Magna Charta ging der Streit zwischen König und Adel um feudale Privilegien weiter. Als Vertretung der Stände gewann das Parlament eine immer stärkere Position. 19Wegen der im Vergleich zum europäischen Kontinent durchlässigeren Ständeordnung galt das Parlament bald als Repräsentant aller Untertanen. In der frühen Neuzeit kam es zur Ausarbeitung von „ Rechten der Engländer “, die an die Stelle ständischer Sonderrechte getreten sind. 20Die ersten sind die Petition of Right von 1628, die Habeas-Corpus-Akte von 1679 und die Bill of Rights von 1689.
24Die Petition of Right wurde gegen König Karl I. (1625–1649) 1627 durchgesetzt. Sie knüpfte an die Magna Charta an und war lediglich eine Bestätigung bereits vorhandener Gesetze und Statuten des Reiches. Die Diskussion um die Petition of Right hat insbesondere Sir Edward Coke (1552–1634) geprägt. Er wies auf die Bedeutung von „fundamental rights“ der Engländer hin. 21Für ihn stand die grundrechtliche Trias von Leben, Freiheit und Eigentum im Vordergrund. Jedoch handelte es sich bei diesen um Rechte des englischen Bürgers, nicht des Menschen schlechthin.
25Erst mit der Habeas-Corpus-Akte wurde 1679 gegen König Karl II. (1649–1685) eine wirkliche Rechtsgewährleistung mit Verfahrensgarantien bei Freiheitsentziehung durchgesetzt. Sie beinhaltet einen Schutz vor willkürlichen Verhaftungen . Der Erlass war Produkt der Auseinandersetzung zwischen dem englischen Parlament und dem König, der das Ziel hatte, England in einen absolutistischen Staat zu verwandeln. Erstmals gab es hier nicht nur einen Schutz vor willkürlicher Freiheitsentziehung überhaupt, sondern auch Vorschriften im Fall der Freiheitsentziehung , wie etwa die Benennung des Haftgrundes und die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Haftrichters sowie zeitliche Vorgaben für das Verfahren.
26Die fortlaufenden Auseinandersetzungen zwischen Volk, Parlament und König Jacob II. (1685–1688) führten zur so genannten Glorious Revolution von 1688 , in der die englische Nation ihr Widerstandsrecht gegen den des Verfassungsbruchs bezichtigten König Jacob ausübte. Infolge dieser Revolution kam es zur Manifestierung der Bill of Rights , die als Reaktion auf die Unterdrückungsaktivitäten König Jacobs umfangreiche Garantien durch den neuen Herrscher William III. (1689–1702) gewährte. Im Einzelnen wurden Rechte des Parlaments, sowie etliche individuelle Rechte gewährt, darunter das Recht, Petitionen an den König zu richten, und das Verbot von Verhaftung und gerichtlicher Verfolgung aufgrund solcher Petitionen. 22
27Doch die endgültige Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte erfolgte erst durch die Revolutionen am Ende des 18. Jahrhunderts in Nordamerika und Frankreich.
IV.Die Entwicklung in Nordamerika
28Die Entstehung der Grundrechtskataloge 23in Nordamerika wurde von mehreren besonderen historischen Faktoren geprägt.
29Zunächst spielten die Vorgaben der Englischen „ Civil Liberties “ eine Rolle. Gerade im Konflikt mit der englischen Krone konnten sich die Kolonisten auf den Präzedenzfall der Glorious Revolution von 1689 berufen und so die Ausübung ihres Widerstandsrechts begründen. 24
Hinzu kam die einzigartige Situation der Neubesiedelung des nordamerikanischen Kontinents . Institutionen des öffentlichen Lebens mussten erst eingerichtet werden, wobei man nicht an eine feudale Gesellschaftsordnung gebunden war. So ergab sich die Möglichkeit einer vollständigen gesellschaftlichen Neuordnung , bei der die Gedanken der Naturrechtslehre bestimmend werden konnten. 25
Die Geschichte der nordamerikanischen Rechtsverfassungen beginnt mit Abkommen und Deklarationen, die zunächst überwiegend wirtschaftliche Gesichtspunkte enthielten. Die Siedler der Neu-England-Staaten schlossen zunächst so genannte Pflanzungsverträge , die Basis für die Rechtmäßigkeit ihrer ökonomischen Handlungen werden sollten. 26Inhaltlich sind es Verträge der englischen Ansiedler über ihre religiösen und politischen Prinzipien, die sie bei der Gründung der Kolonien einhalten wollten. 27Hierzu gehören der „ Mayflower Compact “ von 1620 zur Gründung von New-Plymouth, die Verträge von Massachusetts 1629 und Providence 1636, sowie Connecticut 1638.
30Daneben gab es erste zaghafte Freiheitsverbürgungen , wie beispielsweise die Concessions and Agreements of the Proprietors, Freeholders and Inhabitants of the Province of West New Jersey vom 3.3.1677 28, sowie die New York Charter of Liberties von 1683 29.
Was die allgemeine Rechtsgeltung anging, so schuf man zunächst kein neues Recht, sondern rezipierte die englischen „ birth-rights “ aus den „ fundamental laws “, wie sie Coke lehrte und die in den „Commentaries on the laws of England“ von William Blackstone ihren Niederschlag (und Höhepunkt) gefunden hatten. 30Bei diesen Rechten handelte es sich allerdings um Bürgerrechte gegenüber der englischen Krone und nicht um Rechte, die eine politische Partizipation oder gar so etwas wie Selbstbestimmung gewährten und deren Begründung letztlich durch den (weit entfernten) englischen Staat vermittelt wurde. Es waren letztlich Rechte, deren Nutzen in der neuen Welt geringfügig war, die also nur der Anfang einer Rechtsstatuierung sein konnten.
31Die Ferne des Mutterlandes, die Unterdrückung durch den englischen Staat bei gleichzeitig geringer Durchsetzung und Garantie von rechtlichen Positionen sowie die Erhebung vielfältiger Steuern bei gleichzeitig mangelnder Mitbestimmung forderten eine eigenständige rechtliche und politische Entwicklung dieser Staaten geradezu heraus. Diese Situation mündete letztlich in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zwischen 1764 und 1776. In dieser Zeit gab es vielfältige – geistige – Auseinandersetzungen um die zukünftige rechtliche Basis der unabhängigen Kolonien.
Читать дальше