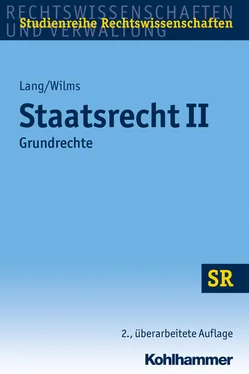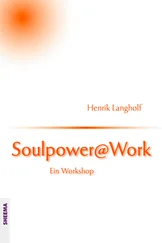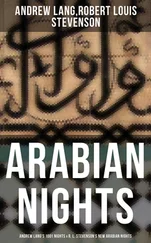248Sofern der Gesetzgeber die Exekutive zum Eingriff in Grundrechte ermächtigen will, enthält Art. 80 besondere Anforderungen für den Erlass von Rechtsverordnungen . Insbesondere müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung gesetzlich bestimmt sein (Art. 80 Abs. 1 S. 2). 129
Welche Fragen hierbei dem Vorbehalt einer parlamentarischen Regelung unterliegen ( Parlamentsvorbehalt ), ist nach der Wesentlichkeitstheorie zu bestimmen. 130Es ist ständige Rechtsprechung,
„dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, – losgelöst vom Merkmal des ‚Eingriffs‘ – in grundlegenden normativen Bereichen, zumal im Bereich der Grundrechtsausübung, soweit diese staatlicher Regelung zugänglich ist, alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen. […] In welchen Bereichen danach staatliches Handeln einer Rechtsgrundlage im förmlichen Gesetz bedarf, lässt sich nur im Blick auf den jeweiligen Sachbereich und die Intensität der geplanten oder getroffenen Regelung ermitteln. Die verfassungsrechtlichen Wertungskriterien sind dabei in erster Linie den tragenden Prinzipien des Grundgesetzes, insbesondere den vom Grundgesetz anerkannten und verbürgten Grundrechten zu entnehmen.“ 131
249Die Verpflichtung des Gesetzgebers, alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen, besteht in erster Linie für Entscheidungen, die für die Grundrechtsausübung wesentlich sind. Alle Maßnahmen, die in Grundrechte eingreifen, müssen daher vom Gesetzgeber zumindest in den wesentlichen Grundzügen selbst bestimmt werden, anstatt die Festlegung der Grundrechtsgrenzen dem Ermessen der Exekutive zu überlassen. 132Der Gesetzesvorbehalt erstarkt insoweit zum Parlamentsvorbehalt. 133Maßgebend für die Abgrenzung ist vor allem die Intensität der Grundrechtsbetroffenheit . 134
250Grundsätzlich muss das einschränkende Gesetz neben den Voraussetzungen, die einen Eingriff möglich machen, auch Angaben zum Hintergrund der Rechtfertigung machen, insbesondere das Ziel der Einschränkung. 135
251 c) Einfache Gesetzesvorbehalte.Unterliegt ein Grundrecht einem einfachen Gesetzesvorbehalt, so kann es durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. An das einschränkende Gesetz werden hier über die allgemeinen verfassungsrechtlichen Regeln hinaus keine weiteren Anforderungen gestellt. 136Das grundrechtseinschränkende Gesetz muss lediglich in formeller und materieller Hinsicht verfassungsmäßig sein.
252Beispiele für Grundrechte mit einfachem Gesetzesvorbehalt sind:
– das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Art. 2 Abs. 2 S. 1 und 3;
– die Freiheit der Versammlung unter freiem Himmel, Art. 8 Abs. 1 und Abs. 2;
– das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Art. 10 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1;
– die Berufsfreiheit (vgl. Art. 12 Abs. 1 S. 2);
– die Eigentumsgarantie (vgl. Art. 14 Abs. 1 S. 2).
253 d) Qualifizierte Gesetzesvorbehalte.Qualifizierte Gesetzesvorbehalte sehen zusätzliche, besondere Voraussetzungen vor, die das grundrechtseinschränkende Gesetz erfüllen muss. Sie fordern nicht nur eine gesetzliche Grundlage für den Grundrechtseingriff, sondern verlangen des Weiteren, dass das einschränkende Gesetz an eine bestimmte Situation anknüpft, bestimmten Zwecken dient oder bestimmte Mittel benutzt. 137Das Schrankengesetz muss somit über die formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit hinaus weiteren inhaltlichen Anforderungen genügen, die sich den jeweiligen Grundrechtsbestimmungen entnehmen lassen.
254Bsp. für Grundrechte mit qualifiziertem Gesetzesvorbehalt sind:
– die Kommunikationsfreiheiten des Art. 5 Abs. 1 (vgl. Art. 5 Abs. 2);
– das Elternrecht des Art. 6 Abs. 2 (vgl. Art. 6 Abs. 3);
– das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (vgl. Art. 10 Abs. 2 S. 2);
– die Freizügigkeit (vgl. Art. 11 Abs. 2);
– die Eigentumsgarantie (vgl. Art. 14 Abs. 3 S. 2);
– der Schutz vor Auslieferung (vgl. Art. 16 Abs. 2 S. 2).
4.Einschränkungen kraft kollidierenden Verfassungsrechts (verfassungsimmanente Grundrechtsschranken)
255Einige Grundrechte des Grundgesetzes enthalten ihrem Wortlaut nach keine Einschränkungen, wie z. B. die Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2), die Kunst- und die Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 S. 1), der Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 Abs. 1) und die Freiheit der Versammlung in geschlossenen Räumen (Art. 8 Abs. 1). 138
Dies bedeutet allerdings nicht, dass diese vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechte keinen Beschränkungen unterliegen. Grundrechte, die keinen ausdrücklichen Gesetzesvorbehalt aufweisen, sind zwar vorbehaltlos, aber nicht schrankenlos . 139Das BVerfG betont allerdings, dass die Schranken vorbehaltloser Grundrechte „nur von der Verfassung selbst zu bestimmen sind.“ 140Im Einzelnen führt das Gericht hierzu aus:
„Nur kollidierende Grundrechte Dritter und andere mit Verfassungsrang ausgestattete Rechtswerte sind mit Rücksicht auf die Einheit der Verfassung und die von ihr geschützte gesamte Wertordnung ausnahmsweise imstande, auch uneinschränkbare Grundrechte in einzelnen Beziehungen zu begrenzen. Dabei auftretende Konflikte lassen sich nur lösen, indem ermittelt wird, welche Verfassungsbestimmung für die konkret zu entscheidende Frage das höhere Gewicht hat. Die schwächere Norm darf nur so weit zurückgedrängt werden, wie das logisch und systematisch zwingend erscheint; ihr sachlicher Grundwertgehalt muss in jedem Fall respektiert werden.“ 141
256Einschränkungen vorbehaltloser Grundrechte können demnach nur durch kollidierendes Verfassungsrecht gerechtfertigt werden. Es handelt sich dabei um verfassungsimmanente Grundrechtsschranken. 142In Betracht kommen Grundrechte Dritter und andere mit Verfassungsrang ausgestattete Rechtswerte. Voraussetzung ist jedoch stets eine gesetzliche Eingriffsermächtigung. In vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte kann somit durch ein Gesetz eingegriffen werden, welches kollidierendes Verfassungsrecht, d. h. Grundrechte Dritter oder andere Rechtsgüter von Verfassungsrang, konkretisiert. 143Erforderlich sind ferner eine Güterabwägung und ein Ausgleich der kollidierenden Güter im Wege der praktischen Konkordanz .
Im Ergebnis kommt diese Konfliktlösung einem Gesetzesvorbehalt gleich, der dadurch qualifiziert ist, dass das Schrankengesetz dem Schutz kollidierenden Verfassungsrechts dienen muss. 144
257Anderen Lösungswegen hat das BVerfG eine Absage erteilt. Dies gilt insbesondere für den Versuch, die Schranken anderer Grundrechte auf die vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechte zu übertragen. 145So ist etwa die in Art. 5 Abs. 2 geregelte Schranke der allgemeinen Gesetze bereits aus systematischen Gründen nicht auf die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 anwendbar, da sie allein auf die Grundrechte des Art. 5 Abs. 1 bezogen ist. 146Auch die Schrankentrias des Art. 2 Abs. 1 kann nicht analog auf andere Grundrechte angewandt werden. 147
258Als kollidierendes Verfassungsrecht kommt z. B. in Betracht: 148
– der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung (Art. 20);
– das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1);
– die Schutzpflicht zugunsten des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1);
– der Jugendschutz (Art. 5 Abs. 2);
– die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Hochschulen (Art. 5 Abs. 3);
– die staatliche Schulhoheit (Art. 7 Abs. 1);
– das Eigentum Dritter (Art. 14);
– das Staatsziel des Tierschutzes (Art. 20a);
– die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5);
– die Einrichtung und die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr (Art. 12a, Art. 87a);
Читать дальше