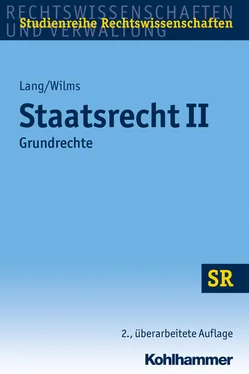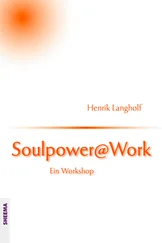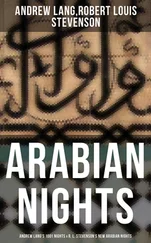– Bestand und Funktionsfähigkeit der Sozialversicherung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 12).
259Soll ein vorbehaltloses Grundrecht durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden, setzt dies eine konkrete normative Aussage im Grundgesetz voraus. 149Nicht ausreichend ist der Hinweis auf bloße Kompetenz-, Ermächtigungs- und Organisationsvorschriften. 150Ebenso wenig genügt der Verweis auf den „Schutz der Verfassung“ oder die Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege. 151Vielmehr ist es nach der Rechtsprechung des BVerfG geboten,
„anhand einzelner Grundgesetzbestimmungen die konkret verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgüter festzustellen, die bei realistischer Einschätzung der Tatumstände der Wahrnehmung des [vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechts] widerstreiten, und diese in Konkordanz zu diesem Grundrecht zu bringen.“ 152
260Wegen des aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Grundsatzes des Vorbehalts des Gesetzes erfordert die Grundrechtseinschränkung durch kollidierendes Verfassungsrecht stets eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage . 153Denn die einen Eingriff rechtfertigenden immanenten Schranken ersetzen lediglich den Gesetzesvorbehalt, nicht aber das für einen Eingriff notwendige ermächtigende Gesetz. 154
261Ausgangspunkt des BVerfG ist der Grundsatz der Einheit der Verfassung und die von ihr geschützte Wertordnung. 155Konflikte aus kollidierendem Verfassungsrecht lassen sich daher nicht lösen, indem eine bestimmte Rangordnung der Grundrechte und sonstigen Verfassungsgüter aufgestellt wird. 156Vielmehr ist eine Einzelfallabwägung vorzunehmen, die die Besonderheiten des jeweiligen Grundrechts berücksichtigt und eine Harmonisierung des Grundrechtskonflikts bewirkt. 157Ziel ist die Herbeiführung eines angemessenen Interessenausgleichs durch Herstellung praktischer Konkordanz , 158d. h. ein
„verhältnismäßiger Ausgleich der gegenläufigen, gleichermaßen verfassungsrechtlich geschützten Interessen mit dem Ziele ihrer Optimierung.“ 159
262Dies bedeutet, dass ein schonender Ausgleich in dem Sinne herbeizuführen ist, dass alle beteiligten Verfassungsgüter zu optimaler Wirksamkeit gelangen können: 160
„Beide Verfassungswerte müssen daher im Konfliktsfall nach Möglichkeit zum Ausgleich gebracht werden; lässt sich dies nicht erreichen, so ist unter Berücksichtigung der falltypischen Gestaltung und der besonderen Umstände des Einzelfalles zu entscheiden, welches Interesse zurückzutreten hat.“ 161
Hinweis für die Fallbearbeitung: In Übungsarbeiten formuliert man zur Operationalisierung des Grundsatzes praktischer Konkordanz am besten, dass der Grundsatz gebiete, jedes Grundrecht soweit als möglich zu entfalten und dabei nur soweit als notwendig zu begrenzen.
263Nicht einheitlich beurteilt wird die Frage, ob der Anwendungsbereich kollidierenden Verfassungsrechts als Eingriffsrechtfertigung auf vorbehaltlose Grundrechte beschränkt ist, oder ob damit darüber hinaus auch Eingriffe in Grundrechte gerechtfertigt werden können, die einem einfachen oder qualifizierten Gesetzesvorbehalt unterliegen. 162
5.Anforderungen an grundrechtseinschränkende Gesetze (Schranken-Schranke)
264Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung eines Grundrechtseingriffs setzt voraus, dass das grundrechtseinschränkende Gesetz seinerseits in formeller und materieller Hinsicht mit der Verfassung in Einklang steht (sog. Schranken-Schranken oder Gegenschranken ). Die Begriffe bezeichnen die Beschränkungen, denen der Gesetzgeber unterliegt, wenn er der Grundrechtsausübung Schranken zieht. 163In anderen Worten gelten auch Grundrechtsschranken nicht unbeschränkt. 164
Das einschränkende Gesetz muss zunächst formell ordnungsgemäß zustande gekommen sein, d. h. unter Einhaltung der Kompetenzordnung des Grundgesetzes (Art. 70 ff.) und des Gesetzgebungsverfahrens (Art. 76 ff. bei Bundesgesetzen). In materieller Hinsicht sind insbesondere das Verhältnismäßigkeitsprinzip, der Bestimmtheitsgrundsatz und das Rückwirkungsverbot zu beachten, des Weiteren die in Art. 19 verankerten Anforderungen an Grundrechtseinschränkungen (Verbot des Einzelfallgesetzes, Zitiergebot und Wesensgehaltsgarantie).
265 a) Das Verhältnismäßigkeitsprinzip.Das Verhältnismäßigkeitsprinzip – auch als Übermaßverbot bezeichnet – besagt, dass der Zweck jedes staatlichen Handelns in angemessenem Verhältnis zu dem gewählten Mittel stehen muss. 165Die Freiheit des Einzelnen darf nur soweit eingeschränkt werden, wie dies im Interesse des Allgemeinwohls unabdingbar ist. Ursprünglich als rechtsstaatliche Anforderung an die Rechtmäßigkeit von Eingriffen durch die Verwaltung in die konstitutionellen Freiheitsrechte („Eigentum und Freiheit“) entwickelt, gehört das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu den Leitsätzen, die die Rechtmäßigkeit jeglichen staatlichen Handelns betreffen, 166
„die sich als übergreifende Leitregeln allen staatlichen Handelns zwingend aus dem Rechtsstaatsprinzip ergeben und deshalb Verfassungsrang haben“. 167
266Das Verhältnismäßigkeitsprinzip findet seine klassische Anwendung im Verhältnis Staat-Bürger in der Grundrechtslehre, wo zu den Voraussetzungen eines rechtmäßigen Eingriffs auch die Verhältnismäßigkeit gehört:
„Nach diesem mit Verfassungsrang ausgestatteten Grundsatz sind Eingriffe in die Freiheitssphäre nur dann und insoweit zulässig, als sie zum Schutz öffentlicher Interessen unerlässlich sind; die gewählten Mittel müssen in einem vernünftigen Verhältnis zum angestrebten Erfolg stehen.“ 168
267Die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfolgt in zwei Schritten. Zuerst ist der angestrebte Zweck des staatlichen Handelns zu bestimmen und außerdem festzulegen, aus welchem Mittel das staatliche Handeln besteht, mit dem der angestrebte Erfolg bewirkt werden soll. Anschließend sind der Zweck und das dafür gewählte staatliche Mittel zueinander in Beziehung zu setzen. Ein Mittel ist danach nur verhältnismäßig, wenn es zur Verwirklichung des angestrebten Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen ist. Dieser letzte Schritt stellt die eigentliche Verhältnismäßigkeitsprüfung dar (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, Proportionalität).
268Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat in der Rechtsprechung des BVerfG für einzelne Grundrechte besondere Ausprägungen erfahren. Dies gilt insbesondere für die Wechselwirkungslehre zu Art. 5 Abs. 1 und die Drei-Stufen-Theorie im Rahmen des Art. 12 Abs. 1. 169
269 aa) Verfassungslegitimer Zweck.Für die Ermittlung des Zwecks des staatlichen Handelns ist zunächst darauf abzustellen, was die staatlichen Stellen selbst als angestrebten Erfolg verlautbaren. So lässt sich das Ziel, das der Gesetzgeber durch den Erlass eines Gesetzes verwirklichen will, aus dem Gesetzestext, aus der Gesetzesbegründung oder den parlamentarischen Beratungen ermitteln. 170Bei der Wahl des zu verfolgenden Zwecks und der dafür einzusetzenden Mittel ist der Gesetzgeber freier als die Verwaltung, die im Rahmen ihrer Vollzugstätigkeit an die gesetzgeberische Entscheidung gebunden ist. 171
Grundsätzlich kommen dem Gesetzgeber bei der Frage, welche Zwecke er mit welchen Mitteln verfolgen will, eine Einschätzungsprärogative und ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Zweckbestimmung kann sich allerdings auch aus dem Gesetzesvorbehalt des Grundrechts ergeben, wie dies etwa bei Art. 5 Abs. 2 der Fall ist. 172
270Stets muss das staatliche Handeln einem legitimen Zweck dienen. Dies bedeutet, dass der verfolgte Zweck mit der staatlichen Ordnung, insbesondere mit der Verfassung vereinbar sein muss. Innerhalb dieses Rahmens überschreitet der Gesetzgeber seinen Beurteilungsspielraum nur,
Читать дальше