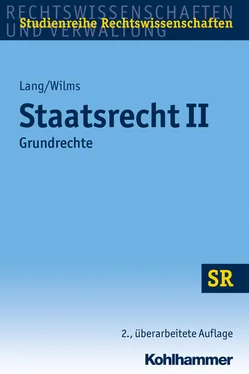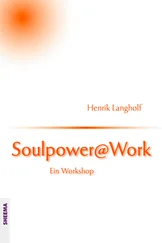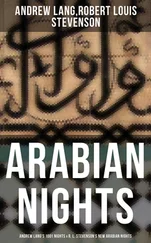„wenn seine Erwägungen so offensichtlich fehlsam sind, dass sie vernünftigerweise keine Grundlage für gesetzgeberische Maßnahmen abgeben können.“ 173
271Beispielsweise können wirtschaftliche oder soziale Aspekte zu einem solchen legitimen Zweck führen. 174
272 bb) Geeignetheit.Geeignet ist jedes Mittel, das prinzipiell für die Verwirklichung des angestrebten Zwecks dienlich ist. Dies ist der Fall,
„wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert werden kann“. 175
273Das gewählte Mittel muss nicht das bestmögliche sein und nicht in jedem Einzelfall Wirkung entfalten. 176Es besteht kein Optimierungsgebot. 177Vielmehr genügt es, wenn die abstrakte Möglichkeit der Zweckerreichung besteht, die staatliche Maßnahme also „ nicht von vornherein untauglich “ ist, 178sondern einen Beitrag zur Zielerreichung leistet. 179Je nach Fallkonstellation kann es eine große Anzahl von geeigneten Mitteln neben dem gewählten geben.
274 cc) Erforderlichkeit.Erforderlich ist das Mittel, das von allen geeigneten, gleich wirksamen Mitteln die am wenigsten einschneidende Maßnahme darstellt . Eine staatliche Maßnahme darf – wie das BVerfG formuliert hat – mithin nicht über das zur Verfolgung ihres Zwecks erforderliche Maß hinaus- und nicht weitergehen, als der mit ihr intendierte Schutzzweck reicht. 180Im klassischen Staat-Bürger-Verhältnis ist damit das Mittel erforderlich, das den Bürger am wenigsten belastet ( Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs ). 181An der Erforderlichkeit fehlt es, wenn
„ein gleich wirksames, aber für den Grundrechtsträger weniger und Dritte und die Allgemeinheit nicht stärker belastendes Mittel zur Erreichung des Ziels zur Verfügung steht“. 182
275 Nicht erforderlich ist das Mittel, wenn ein milderes Mittel ausreicht. 183Es muss sich eindeutig feststellen lassen, dass zur Erreichung des verfolgten Zwecks andere, weniger einschneidende Mittel zur Verfügung stehen. 184Dies ist nicht nur im Hinblick auf den Betroffenen selbst, sondern auch im Hinblick auf Dritte zu entscheiden. 185
276 dd) Angemessenheit.Die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne (Angemessenheit, Zumutbarkeit oder Proportionalität) verlangt, dass die Maßnahme in angemessenem Verhältnis zu dem Gewicht und der Bedeutung des Grundrechts steht. 186Dies erfordert, dass
„bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleibt, die Maßnahme also die Betroffenen nicht übermäßig belastet.“ 187
277Die Angemessenheitsprüfung besteht in einer umfassenden Abwägung zwischen den grundrechtlich geschützten Rechtsgütern und den entgegenstehenden öffentlichen Interessen, die eine Einschränkung des Grundrechts erfordern. 188Angemessen ist ein erforderliches Mittel nur, wenn der mit der Maßnahme verbundene Eingriff nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache steht. 189Bildlich gesprochen darf man nicht „mit Kanonen auf Spatzen schießen “.Handelt es sich um einen besonders intensiven Eingriff, so muss die Zumutbarkeit gegebenenfalls durch Übergangs-, Ausgleichs- oder Ausnahmevorschriften sichergestellt werden. 190
278 b) Die Wesensgehaltsgarantie gemäß Art. 19 Abs. 2.Art. 19 Abs. 2 bestimmt, dass ein Grundrecht in keinem Falle in seinem Wesensgehalt angetastet werden darf. Dieser Wesensgehalt ist für jedes einzelne Grundrecht gesondert zu bestimmen. 191
Die Wesensgehaltsgarantie gilt für alle Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte . Insbesondere ist ihr Anwendungsbereich nicht auf Grundrechte, die unter Gesetzesvorbehalt stehen, beschränkt. 192
279Umstritten ist, ob der Wesensgehalt eines Grundrechts absolut oder relativ zu bestimmen ist.
Nach der Theorie vom absoluten Wesensgehalt besitzt jedes Grundrecht einen unantastbaren Kernbereich , der unabhängig von einer Abwägung im jeweiligen Einzelfall feststeht. 193Dieser absolut geschützte Kernbestand stellt die „Grundsubstanz“ eines Grundrechts, 194seinen „unverzichtbaren Mindestinhalt“ dar. 195
Demgegenüber geht die Theorie vom relativen Wesensgehalt davon aus, dass in jedem einzelnen Fall unter Berücksichtigung aller beteiligten Interessen anhand einer Abwägung festzustellen ist, ob der Wesensgehalt eines Grundrechts angetastet ist. 196Eine Verletzung des Wesensgehalts scheidet danach aus, wenn im Einzelfall dem Grundrecht das geringere Gewicht für die konkret zu entscheidende Frage beizumessen ist. 197Gegen diese Auffassung spricht jedoch, dass die Bedeutung des Art. 19 Abs. 2 damit nicht über die Prüfung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit hinausginge. 198
280Darüber hinaus ist umstritten, ob die Wesensgehaltsgarantie generell , d. h. im Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung des Grundrechts innerhalb der Verfassungsordnung, oder individuell , also bezogen auf seine Bedeutung für den jeweiligen Grundrechtsberechtigten zu interpretieren ist. 199Richtigerweise ist zu differenzieren. Jedenfalls für staatliche Eingriffe in das Recht auf Leben, die aufgrund des Art. 2 Abs. 2 S. 3 nicht prinzipiell ausgeschlossen sind, kann die Wesensgehaltsgarantie nur im Hinblick auf die Gewährleistung für die Allgemeinheit verstanden werden, da ein Eingriff die Rechtsposition des betroffenen Grundträgers vollständig beseitigt. 200Andernfalls ließe die Verfassung in Art. 2 Abs. 2 S. 3 etwas zu (nämlich einen Eingriff in das Grundrecht auf Leben), das durch Art. 19 Abs. 2 (Wesensgehaltssperre) ausgeschlossen wäre. Eine solche Interpretation kann aber nicht das Ergebnis einer zutreffenden systematischen Auslegung sein kann. 201Das Problem lässt sich auch nicht über eine Hierarchisierung der Vorschriften lösen. Jedenfalls hinsichtlich ursprünglicher Verfassungsnormen sind etwaige Spannungsverhältnisse nach Maßgabe des Grundsatzes der Einheit der Verfassung aufzulösen. Für alle anderen Grundrechte ist der Wesensgehalt hingegen im Zweifel individuell zu bestimmen. 202
281 c) Das Zitiergebot gemäß Art. 19 Abs. 1 S. 2.Art. 19 Abs. 1 S. 2 bestimmt, dass ein grundrechtseinschränkendes Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen muss. Dem Zitiergebot kommt eine Warn- und Besinnungsfunktion für den Gesetzgeber zu („psychologische Schranke“ 203):
„Indem das Gebot den Gesetzgeber zwingt, solche Eingriffe im Gesetzeswortlaut auszuweisen, will es sicherstellen, dass nur wirklich gewollte Eingriffe erfolgen; auch soll sich der Gesetzgeber über die Auswirkungen seiner Regelungen für die betroffenen Grundrechte Rechenschaft geben (Warn- und Beweisfunktion).“ 204
282Außerdem hat das Zitiergebot eine Klarstellungsfunktion für die Gesetzesauslegung durch die rechtsanwendenden Organe. 205Darüber hinaus dient die Vorschrift der Rechtsklarheit, da auch der Bürger, der nicht über juristische Kenntnisse verfügt, den Gesetzen das Ausmaß der Grundrechtseinschränkungen soll entnehmen können (sog. Informationsfunktion ). 206
Verstößt der Gesetzgeber gegen Art. 19 Abs. 1 S. 2, so hat dies die Nichtigkeit des Gesetzes zur Folge. 207
Ein Beispiel für die Befolgung des Zitiergebots findet sich in § 20 VersG.
283Infolge der restriktiven Handhabung des Art. 19 Abs. 1 S. 2 durch die Rechtsprechung des BVerfG ist die praktische Bedeutung des Zitiergebots gering . 208Einleuchtend ist, dass Art. 19 Abs. 1 S. 2 auf vorkonstitutionelle Gesetze keine Anwendung findet, denn da Art. 19 Abs. 2 noch nicht galt, konnte er vom Gesetzgeber auch nicht eingehalten werden. 209Gleiches soll aber gelten, wenn ein nachkonstitutionelles Gesetz lediglich bereits geltende Grundrechtsbeschränkungen unverändert oder mit geringen Abweichungen wiederholt. 210
Читать дальше