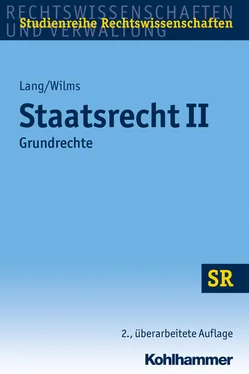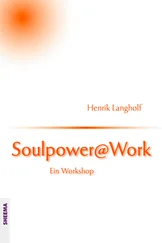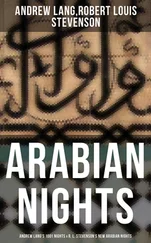Bei durch den Staat nicht beabsichtigten mittelbaren Beeinträchtigungen kann danach differenziert werden, ob sich solche Beeinträchtigungen als typisch (dann mittelbarer Grundrechtseingriff) oder atypisch (dann kein Grundrechtseingriff) darstellen.
214Diese Grundsätze lassen sich anschaulich an der eingriffsdogmatischen Bewältigung von Warnungen, Hinweisen, Informationen und geschäftsschädigenden Äußerungen der öffentlichen Gewalt exemplifizieren.
Warnt der Staat beispielsweise vor dem Kauf glykolhaltiger Weine und geht daraufhin der Absatz belasteter Weine zurück, gilt Folgendes: Die staatliche Warnung führt zu einer mittelbaren Beeinträchtigung, mittelbar, weil nicht das staatliche Handeln selbst, sondern erst die sinkende Nachfrage der Verbraucher zum Umsatzrückgang führt, die aber beabsichtigt ist, weil die Warnungen gerade dazu dienen sollten, dass Verbraucher vom Verzehr glykolhaltiger Weine Abstand nehmen. Es handelt sich daher um einen mittelbaren Grundrechtseingriff.
Führt die Warnung vor dem Verzehr glykolhaltiger Weine dazu, dass Verbraucher auch unbelastete Weine meiden, kommt es für die Qualifizierung der mittelbaren Beeinträchtigung als Eingriff zunächst auf deren Vorhersehbarkeit an. Waren die Auswirkungen auf die grundrechtlichen Schutzgüter vorhersehbar, kommt ihnen jedenfalls nach der Rechtsprechung Eingriffsqualität zu, wenn die Wirkungen keinen Bagatellcharakter haben, sondern ihnen eine gewisse Schwere zukommt. Unvorhersehbare oder atypische Auswirkungen stellen keine Eingriffe dar.
215Im Einzelnen bestehen hinsichtlich der Reichweite des weiten Eingriffsbegriffs noch zahlreiche Unklarheiten . 65Dies gilt insbesondere für die Frage, wann die Schwelle zum Grundrechtseingriff überschritten ist. Überwiegend wird auf den Schutzzweck des jeweiligen Grundrechts sowie die Schwere und Voraussehbarkeit der Beeinträchtigung abgestellt. 66Teilweise wird vorgeschlagen, sich hinsichtlich der Schutzfunktion des einzelnen Grundrechts und der Intensität des Eingriffs am klassischen Grundrechtsbegriff zu orientieren. 67Dieser Auffassung wird entgegengehalten, dass dadurch die umfassende Schutzwirkung der Grundrechte zu pauschal verkürzt werde. 68
216 d) Zusammenfassung zum Grundrechtseingriff.Klar ist: Erfüllt staatliches Handeln die Merkmale des klassischen Grundrechtseingriffs, liegt ohne weiteres ein Grundrechtseingriff vor. In Fallbearbeitungen braucht dann nicht (mehr) auf den weiten Eingriffsbegriff eingegangen zu werden. Bei mittelbar bewirkten Beeinträchtigungen ist zu differenzieren: Erfolgen diese beabsichtigt, liegt ebenfalls ein Grundrechtseingriff vor. Führt mittelbares staatliches Handeln zu unbeabsichtigten Beeinträchtigungen, kommt es auf deren Typizität und Intensität an. Für die erforderliche Abgrenzung zwischen Bagatellen und Eingriff kann auf die Schutzzwecklehre oder die Schwere des Eingriffs abgestellt werden.
217 e) Rechtsprechungsbeispiele.Zum Grundrechtseingriff durch die schon thematisierten staatlichen Warnungen, Hinweise, Informationen und geschäftsschädigende Äußerungen der öffentlichen Gewalt sind mehrere Urteile des BVerfG ergangen, die die Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2) bzw. die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1) betreffen.
218In der Osho-Entscheidung 69hatte das BVerfG darüber zu befinden, ob die Osho-Religionsgemeinschaft durch verschiedene öffentliche Äußerungen der Bundesregierung in ihrem Grundrecht aus Art. 4 verletzt war. 70Zur Zulässigkeit mittelbar-faktischer Grundrechtsbeeinträchtigungen durch staatliches Informationshandeln führt das BVerfG in den Urteilsgründen aus:
„Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über Vorgänge und Entwicklungen, die für den Bürger und das funktionierende Zusammenwirken von Staat und Gesellschaft von Wichtigkeit sind, ist von der der Regierung durch das Grundgesetz zugewiesenen Aufgabe der Staatsleitung auch dann gedeckt, wenn mit dem Informationshandeln mittelbar-faktische Grundrechtsbeeinträchtigungen verbunden sind […]. Die Zuweisung einer Aufgabe berechtigt grundsätzlich zur Informationstätigkeit im Rahmen der Wahrnehmung dieser Aufgabe, auch wenn dadurch mittelbar-faktische Beeinträchtigungen herbeigeführt werden können. Der Vorbehalt des Gesetzes verlangt hierfür keine darüber hinausgehende besondere Ermächtigung durch den Gesetzgeber, es sei denn, die Maßnahme stellt sich nach der Zielsetzung und ihren Wirkungen als Ersatz für eine staatliche Maßnahme dar, die als Grundrechtseingriff im herkömmlichen Sinne zu qualifizieren ist.“ 71
219Auch für den Fall, dass das staatliche Informationshandeln zu mittelbar-faktischen Grundrechtsbeeinträchtigungen führt, hielt das BVerfG eine eigene gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für entbehrlich, da sich die Informationskompetenz der Bundesregierung bereits aus der Aufgabe der Staatsleitung ergebe. Obwohl sich die angegriffenen Äußerungen noch im Rahmen dieser Informationskompetenz bewegt haben, hielt das Gericht die Verfassungsbeschwerde der Osho-Religionsgemeinschaft für begründet, da die Bundesregierung den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht gewahrt habe. 72
220Die schon angesprochene Glykol-Entscheidung 73hatte die Rechtmäßigkeit einer staatlichen Warnung vor dem Genuss diethylenglykolhaltiger Weine zum Gegenstand. Das Bundesgesundheitsministerium hatte als Reaktion auf den „Glykolskandal“ eine Liste belasteter Weine veröffentlicht, auf der die betroffenen Abfüllbetriebe namentlich genannt waren, um dem Verbraucher eine Identifizierung des beanstandeten Weins zu ermöglichen.
Nach Auffassung des BVerfG beeinträchtigen
„marktbezogene Informationen des Staates […] den grundrechtlichen Gewährleistungsbereich der betroffenen Wettbewerber nicht, sofern der Einfluss auf wettbewerbserhebliche Faktoren ohne Verzerrung der Marktverhältnisse nach Maßgabe der rechtlichen Vorgaben für staatliches Informationshandeln erfolgt. Verfassungsrechtlich von Bedeutung sind das Vorliegen einer staatlichen Aufgabe und die Einhaltung der Zuständigkeitsordnung sowie die Beachtung der Anforderungen an die Richtigkeit und Sachlichkeit von Informationen.“ 74
221Darüber hinaus sei die Verbreitung von Informationen unter Berücksichtigung möglicher nachteiliger Wirkungen für die betroffenen Wettbewerber auf das zur Informationsgewährung Erforderliche zu beschränken. Nach den Feststellungen des BVerfG waren die von der Bundesregierung verbreiteten Informationen inhaltlich zutreffend und mit angemessener Zurückhaltung formuliert worden, weshalb das Gericht eine Beeinträchtigung des Grundrechts aus Art. 12 Abs. 1 verneint hat.
222Beide Entscheidungen sind in Teilen des Schrifttums auf Kritik gestoßen . 75Bedenken wurden vor allem hinsichtlich des Verzichts auf eine gesetzliche Grundlage für die Informationstätigkeit der Bundesregierung geäußert. Eine solche sei erforderlich, da nicht von der Aufgabe auf die Befugnis geschlossen werden könne. 76Allgemeine Aufgabenzuweisungen seien als Ermächtigungsgrundlage für einen Grundrechtseingriff nicht ausreichend. 77Auch verwische das BVerfG durch in den Schutzbereich vorverlagerte Abwägungsentscheidungen die Grenze zwischen Schutzbereich und Eingriff. 78
223Das BVerfG scheint auf die Kritiker zuzugehen. 79In einer zu Voraussetzungen und Grenzen staatlicher Informationstätigkeit im Kontext beruflicher Betätigung ergangenen Entscheidung stellt das Gericht zwar zunächst klar, dass die Berufsfreiheit grundsätzlich nicht vor bloßen Veränderungen der Marktdaten und Rahmenbedingungen der unternehmerischen Tätigkeit schütze. Vielmehr unterliege die Wettbewerbssituation und damit auch die erzielbaren Erträge dem Risiko laufender Veränderung. Regelungen, die die Wettbewerbssituation der Unternehmen lediglich im Wege faktisch-mittelbarer Auswirkungen beeinflussen, berührten den Schutzbereich der Berufsfreiheit daher grundsätzlich nicht. Demgemäß sei nicht jedes staatliche Informationshandeln, das die Wettbewerbschancen von Unternehmen am Markt nachteilig verändert, ohne Weiteres als Grundrechtseingriff zu bewerten. 80
Читать дальше