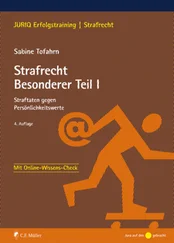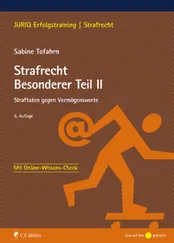5.Strafzumessungsregeln des § 212 Abs. 2 und § 213
22Die h. M. stuft den besonders schweren Fall des § 212 Abs. 2und den minder schweren Fall des § 213als bloße Strafzumessungsregeln ein, die die Rechtsfolgenseite des § 212 (nicht des § 211) betreffen 31. Das soll auch für den benannten minder schweren Fall des § 213 Var. 1 gelten, der demnach kein Privilegierungstatbestand ist 32.
23 a) Benannter minder schwerer Fall, § 213 Var. 1.Dieser liegt vor, wenn der Täter ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einem Angehörigen zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen zum Zorn gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden ist. Die Worte „ohne eigene Schuld“ meinen, dass der Täter keine genügende Veranlassung zur Misshandlung oder schweren Beleidigung gegeben hat 33. Es ist damit also nicht die Schuld im dogmatischen Sinne, d. h. im Sinne der dritten Stufe des Straftataufbaus, in Bezug genommen. Auch sind Misshandlung und Beleidigungnicht im Sinne der Tatbestände der § 223 und § 185 zu verstehen, daher werden auch Misshandlungen seelischer Art und ohne Eintritt eines Körperverletzungserfolgs erfasst. Nur solche Misshandlungen können freilich einen minder schweren Fall begründen, die nach ihrem Gewicht und unter Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls geeignet sind, die Tat als verständliche Reaktion auf die Provokation zu verstehen. Zu denken ist etwa an Fälle, in denen eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit des Täters auf Grund Alkoholgenusses vorliegt 34oder die Tat eine gewisse Nähe zu Notwehrfällen aufweist 35.
24 b) Unbenannte Fälle. Der unbenannte minder schwere Fall i. S. d. § 213 Var. 2und der besonders schwere Fall des § 212 Abs. 2sind nach h. M. im Wege einer Gesamtwürdigung aller strafzumessungsrelevanten Umständei. S. d. § 46 zu bestimmen. Ob § 212 Abs. 2 verwirklicht ist, bestimmt sich nach h. M. ebenfalls im Wege einer Gesamtwürdigung aller strafzumessungsrelevanten Umstände 36. Da § 212 Abs. 2 als Rechtsfolge zwingend die lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht, ergibt die systematische Auslegung, dass ein Fall vorliegen muss, der ebenso schwer wiegt wie bei der Verwirklichung eines Mordmerkmals.
 Klausurtipp
Klausurtipp
Da in strafrechtlichen Prüfungsarbeiten grundsätzlich auf Strafzumessungserwägungen nicht einzugehen ist, empfiehlt es sich, bei besonders schweren und minder schweren Fällen nur auf benannte Merkmale (etwa § 213 Var. 1 oder § 243 I 2) einzugehen. Diese Merkmale sind – nicht anders als Tatbestandsmerkmale – im Wege der Subsumtion zu prüfen. Die Strafzumessungsvorschriften sind im Übrigen im Straftataufbau nach der Schuld, ggf. auch nach einer etwaigen Rücktrittsprüfung, anzusprechen.
Einführende Aufsätze:
Geppert , Zur Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit, insbesondere bei Tötungsdelikten, Jura 2001, 55 (Behandlung zentraler Abgrenzungsfragen unter Einbeziehung der diesbezüglichen Rspr.); Kühl, „Wer einen Menschen tötet“ – Der objektive Tatbestand des Totschlags gemäß § 212 StGB, JA 2009, 321 (Grundlagen zum Tatobjekt „anderer Mensch“ wie auch zur Tathandlung „töten“ unter Einbeziehung von Kausalitäts- und Zurechnungsfragen); Mitsch , Grundfälle zu den Tötungsdelikten, JuS 1995, 787, 888, JuS 1996, 26 (Fallorientierte Übersicht zum Anwendungsbereich der einzelnen Tötungsdelikte).
Übungsfälle:
Dessecker , Zwei Tötungsversuche mit glimpflichem Ausgang, Jura 2000, 592 (Abgrenzung Eventualvorsatz/bewusste Fahrlässigkeit, Versuch und Rücktritt); Eschenbach, Zündende Ideen, Jura 1999, 88 (Verknüpfung zahlreicher Fragen des Allgemeinen Teils mit Tötungsdelikten: Vorsatz, Rechtfertigung, Entschuldigung, mittelbare Täterschaft, Unterlassen); Kalkofen/Sievert , Pech für den Dorfpfarrer, Jura 2011, 229 (zur Problematik der Erfolgszurechnung bei mehraktigem Tatgeschehen [hier: verspäteter Erfolgseintritt]); Kretschmer, Ein folgenschweres letztes Bier, Jura 1998, 244 (Tötung in Notwehr); Kühl/Hinderer , Das Ende einer Ehe, JuS 2010, 697 (lehrreich zur Strafbarkeit der Tötungsverabredung sowie zum versuchten Tötungsdelikt); Rengier/Brand , Antizipierte Verteidigung, JuS 2008, 514 (zur Prüfung des versuchten Tötungsdelikts); Walter , Schwammerl am Wilden Kaiser, Jura 2014, 117 (lehrreich zum Aufbau des [untauglichen] Unterlassungsversuchs in Ansehung eines Tötungsdelikts).
Rechtsprechung:
BGHSt 7, 363– Lederriemen (Hemmschwelle bei Tötungsvorsatz); BGHSt 10, 291– Piepslaute (Abgrenzung von § 212 und § 218); BGHSt 31, 348– Vorwehen (Beginn der Geburt); BGHSt 32, 194– Eröffnungswehen (Beginn der Geburt); BGHSt 57, 183 ff.– Messerstich (Bedeutung der Hemmschwellentheorie); BGH NStZ 1985, 26– mangelnde Behandlung (Kausalität); BGH NJW 2018, 1621– Berliner „Raser“-Fall (Tötungsvorsatz bei illegalem Autorennen).
II.Mord, § 211
1.Geschütztes Rechtsgut und Systematik
25§ 211 schützt ebenfalls das Rechtsgut Leben. Die Rechtsprechung stuft dabei § 211 gegenüber § 212 noch als selbständige Abwandlung (delictum sui generis) und damit als eigenständigen Straftatbestand ein 37. Zur Begründung führt sie vor allem an, dass beide Tatbestände einen jeweils eigenständigen Unwertgehalt beinhalten 38. Diese Ansicht, die inzwischen auch durch ein obiter dictum des 5. Strafsenats des BGH immerhin ins Wanken geraten ist, 39ist jedoch wenig überzeugend, weil dahinter eine „metaphysische Vorstellung“ 40von der besonderen Schwere des Mordes steht. Auch streitet hierfür nicht der Wortlaut des Gesetzes, der noch aus der Zeit des Nationalsozialismus stammt und die Tätertypen „Totschläger“ und „Mörder“ verwendet 41. Die überwiegende Ansicht im Schrifttum sieht § 211 mit Recht als Qualifikationstatbestand zu § 212 an, da die Mordmerkmale zum Totschlag hinzutreten und daher die Strafe des Totschlags schärfen. Zwischen beiden Delikten besteht ein quantitatives Stufenverhältnis 42. Im Falle der Verwirklichung von Mordmerkmalen ist daher lediglich ein graduell höherer Schweregehalt der Tat gegeben. Der Streit hat vor allem Auswirkungen auf die Frage, ob bei persönlichen Mordmerkmalen § 28 Abs. 1 (wenn § 211 ein selbstständiger Tatbestand ist, begründet das Mordmerkmal die Strafbarkeit) oder § 28 Abs. 2 (wenn § 211 eine Qualifikation ist, schärft das Mordmerkmal die Strafe des § 212) zur Anwendung gelangt. Beide Auffassungen können in einzelnen Konstellationen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen 43.
 Klausurtipp
Klausurtipp
Auf die Frage der dogmatischen Einordnung des § 211 sollte in Prüfungsarbeiten nur eingegangen werden, soweit dies (im Rahmen des § 28) für die Falllösung relevant ist. Ansonsten kann ohne nähere Begründung von einem Qualifikationstatbestand ausgegangen und die Prüfung entsprechend aufgebaut werden. § 212 und § 211 können dabei unter einem gemeinsamen Prüfungspunkt abgehandelt werden. Im Einzelfall kann es jedoch „ökonomisch“ sinnvoller sein, beide Vorschriften getrennt zu prüfen. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits eine Strafbarkeit nach § 212 auf Grund des Vorliegens von Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründen zu verneinen ist. Jedoch ist stets sorgfältig auf die Aufgabenstellung zu achten. Sollen alle aufgeworfenen Fragen – ggf. auch im Hilfsgutachten – diskutiert werden, so dürfen die Mordmerkmale nicht vorschnell ausgeblendet werden. Dies gilt ferner in Fällen der Teilnahme, wenn zwar die Strafbarkeit des Haupttäters mangels Schuld entfällt, auf Grund der (limitierten) akzessorischen Haftung des Teilnehmers jedoch die Haupttat genau geprüft werden muss.
Читать дальше
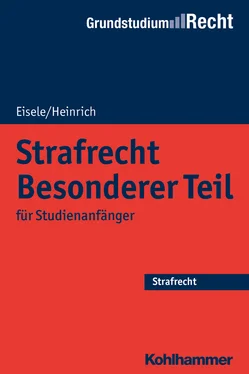
 Klausurtipp
Klausurtipp