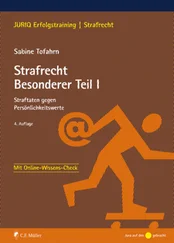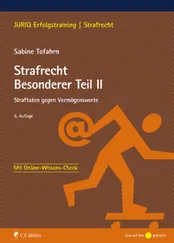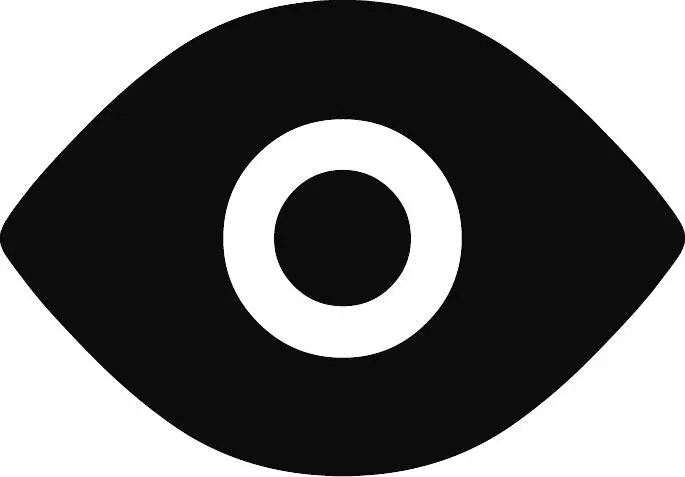 Hinweis
Hinweis
Ausführungen in Klausurlösungen zum Tatobjekt sind nur veranlasst, wenn der Sachverhalt hierfür spezielle Anhaltspunkte bietet.
17 b) Tathandlung und Erfolg.Das Merkmal „töten“ bringt die Tathandlung und den Erfolg (Tod eines anderen Menschen) zum Ausdruck (vgl. auch § 222: „den Tod eines Menschen verursacht“). Hinsichtlich der Kausalität genügt jede, auch nur kurzfristige Verkürzung des Lebens. Entsprechend ist beim unechten Unterlassensdelikt im Wege der sog. hypothetischen Kausalität jede unterlassene Verlängerung des Lebens durch einen Garanten i. S. d. § 13 kausal 21.
Bsp.:O liegt nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt am Boden. T kommt hinzu und erschießt ihn. Ohne den Schuss wäre O nur wenige Minuten später verstorben. – T ist gem. § 212 strafbar, da er das Leben des O verkürzt hat. Denkt man sich die Handlung des T hinweg, wäre der Erfolg nicht in seiner konkreten Gestalt (durch den Schuss) eingetreten. Im Übrigen ist die Reserveursache, dass O ohnehin gestorben wäre, für die Kausalität zwischen Handlung und Erfolg unerheblich (keine Berücksichtigung der hypothetischen Kausalität).
Bsp.: 22Arzt A nimmt sorgfaltspflichtwidrig nicht die erforderliche Behandlung bei Patientin O vor. O kommt zu Tode. Bei hinreichender Behandlung hätte O mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einige Stunden länger gelebt. – Auch hier ist die Kausalität zu bejahen, da der Erfolg bei Vornahme der gebotenen Handlung jedenfalls nicht in seiner konkreten Gestalt eingetreten wäre. A ist daher gem. §§ 222, 13 strafbar. Anderes würde nach dem Grundsatz in dubio pro reo nur dann gelten, wenn nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sondern nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % feststünde, dass O länger gelebt hätte.
18 c) Subjektiver Tatbestand.Hier gewinnt vor allem die Abgrenzung des vorsätzlichen Totschlags in Form von dolus eventualis zur fahrlässigen Tötung i. S. d. § 222 an Bedeutung 23.
 Definition
Definition
Eventualvorsatzliegt nach h. M. vor, wenn der Täter den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges für möglich hält und diesen billigend in Kauf nimmt bzw. sich mit diesem abfindet 24. Lediglich bewusste Fahrlässigkeit soll hingegen anzunehmen sein, wenn der Täter trotz der erkannten Möglichkeit des Erfolgseintritts ernsthaft und nicht lediglich vage auf das Ausbleiben eines tödlichen Erfolgs vertraut hat 25.
19Nach Ansicht der Rechtsprechung liegt es bei gefährlichen Gewalthandlungen(etwa Schüssen, Messerstichen, Würgen) nahe, dass der Täter mit der Möglichkeit eines tödlichen Ausgangs gerechnet und einen solchen vor allem auch gebilligt hat 26. Deshalb soll es grundsätzlich möglich sein, von der objektiven Gefährlichkeit der Handlung auf bedingten Vorsatz zu schließen. Angesichts der hohen Hemmschwelle gegenüber der Tötung eines anderen Menschen ist jedoch auch in Betracht zu ziehen, dass der Täter die Gefahr des Todes nicht erkannt oder jedenfalls darauf vertraut hat, dass ein solcher Erfolg nicht eintritt. Dies ist freilich wiederum in der Regel zu verneinen, wenn bei dem vorgestellten Tatablauf ein tödlicher Ausgang so nahe liegt, dass er nur durch einen glücklichen Zufall verhindert werden kann 27. Ein bloßer Verweis auf die sog. Hemmschwellentheorieist daher nicht ausreichend. Insoweit relativiert der BGH in einer jüngeren Entscheidung die Bedeutung dieser Theorie: 28„Soweit das Landgericht sich ergänzend auf eine ‚Hemmschwellentheorie‘ berufen hat, hat es deren Bedeutung für die Beweiswürdigung verkannt. Es hat schon nicht mitgeteilt, was es darunter im Einzelnen versteht und in welchem Bezug eine solche ‚Theorie‘ zu dem von ihm zu beurteilenden Fall stehen soll (…).“ Nach Ansicht des BGH erschöpft sich die „Hemmschwellentheorie“ somit in einem Hinweis auf § 261 StPO. Zur Verneinung der Billigung des Erfolges verlangt er vielmehr tragfähige Anhaltspunkte dafür, dass der Täter ernsthaft darauf vertraut hat, dass das Opfer nicht zu Tode kommt. Es bedarf daher stets einer sorgfältigen Prüfung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls. Auch bei Vorliegen gefährlicher Gewalthandlungen ist demnach einzelfallbezogen zu prüfen, ob vorsatzkritische Gesichtspunkteauszumachen sind. In jüngster Zeit stellte sich die Frage insbesondere in Auseinandersetzung mit sog. „Raser“-Fällen.
20 Bsp. (Berliner „Raser“-Fall): 29A und B führen – nach spontaner Verständigung an einer Kreuzung – gegen 0:30 Uhr im innerstädtischen Bereich Berlins ein Autorennen durch. Dabei überfahren sie elf ampelgeregelte Kreuzungen, die zumindest teilweise auf Rotlicht geschaltet sind. Schließlich fahren sie fast nebeneinander bei Rotlicht und mit Geschwindigkeiten von 139 bis 149 km/h bzw. 160 bis 170 km/h in einen Kreuzungsbereich ein. Dort kollidiert der auf der rechten Fahrbahn fahrende A mit dem Jeep des O, der bei „grün“ von rechts kommend in die Kreuzung eingefahren war, wobei O zu Tode kommt. Durch den Aufprall wird das Fahrzeug des A auf das Fahrzeug des B geschleudert, wobei dessen Beifahrerin schwer verletzt wird. A und B werden leicht verletzt. – Das objektiv enorm gefährliche Verhalten der beiden Rennteilnehmer weist zunächst in Richtung (eventual-)vorsätzlichen (Tötungs-)Handelns. Wer im – wenn auch nächtlichen – innerstädtischen Verkehr einer Großstadt Ampelsignale missachtet und die zulässige Höchstgeschwindigkeit drastisch überschreitet, wird die Möglichkeit eines Unfalls (unter Einbeziehung Dritter) nicht ausschließen können, sodass bei einem Weiterhandeln eine gewisse Gleichgültigkeit hinsichtlich möglicher Folgen naheliegt. Zu beachten ist freilich der Gesichtspunkt der Eigengefährdung: Bei einer Kollision drohen naturgemäß auch den Rennteilnehmern erhebliche Gefahren für Leib und Leben. Dies spricht dafür, dass die Handelnden auf einen guten Ausgang vertrauen. Insoweit sind wiederum aus den objektiv drohenden Unfallszenarien Rückschlüsse auf die innere Haltung der Handelnden zu ziehen: Je gravierender das drohende Unfallszenario (etwa: Zusammenstoß mit einem Bus oder Lkw) sich darstellt, desto eher wird von einem Vertrauen auf einen guten Ausgang – und damit (bewusst) fahrlässigem Handeln – auszugehen sein 30. Mit Blick auf den Berliner Fall ergab sich die weitere Besonderheit, dass nach den Feststellungen des LG die Angekl. die Möglichkeit eines tödlichen Ausgangs des Rennens erst erkannten und billigend in Kauf nahmen, als sie in die Unfallkreuzung einfuhren; zugleich seien sie zu diesem Zeitpunkt „absolut unfähig gewesen, noch zu reagieren“. Nach § 16 Abs. 1 S. 1 muss der Vorsatz bei der Begehung der Tat vorliegen; nach § 8 S. 1 ist für die Zeit der Tat die Tathandlung (und nicht der Eintritt des Erfolges, § 8 S. 2) entscheidend. Daraus folgt, dass ein der Handlung nur vorausgehender Vorsatz (dolus antecedens) sowie ein – wie hier – der Tat nachfolgender Vorsatz (dolus subsequens), der zum Zeitpunkt der Tatbegehung nicht mehr bzw. noch nicht aktuell ist, nicht ausreicht.
4.Rechtswidrigkeit und Schuld
21Da das Leben für den Rechtsgutsinhaber kein disponibles Rechtsgut ist, scheidet eine rechtfertigende Einwilligungdes Opfers in die Tötung aus. Bei einem ausdrücklichen und ernstlichen Tötungsverlangen kann lediglich der Privilegierungstatbestand des § 216 eingreifen. Auch eine Rechtfertigung nach § 34kommt grundsätzlich nicht in Betracht, da das Leben als höchstes Rechtsgut einer Abwägung nicht zugänglich ist. Es verbleibt hier nur die Möglichkeit einer Entschuldigung unter den Voraussetzungen des § 35.
Читать дальше
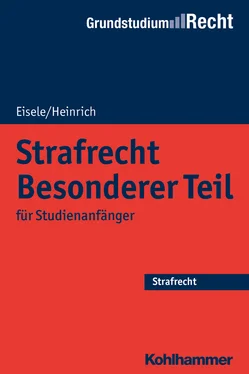
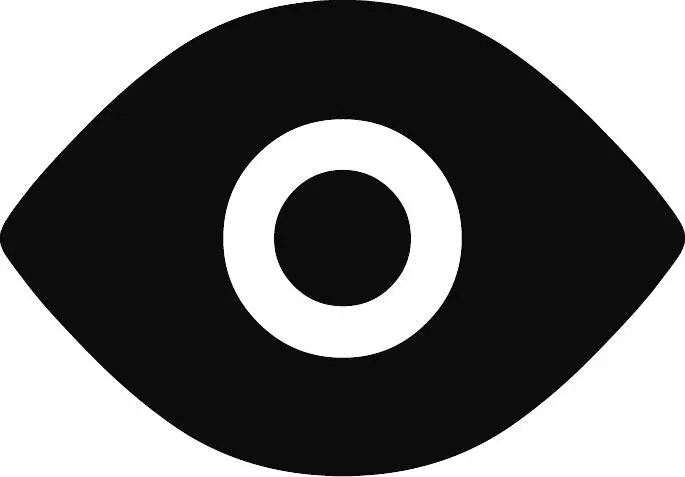 Hinweis
Hinweis Definition
Definition