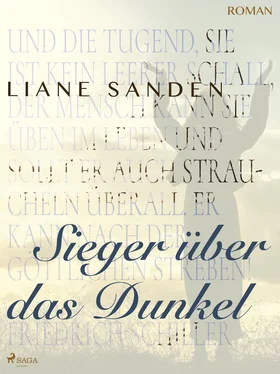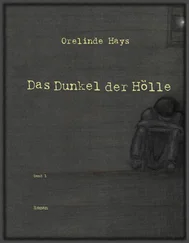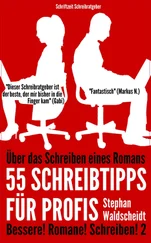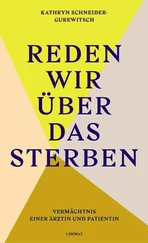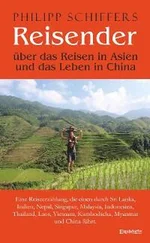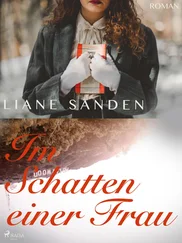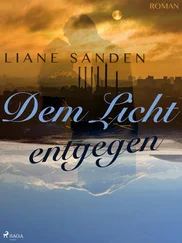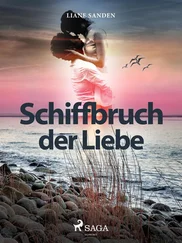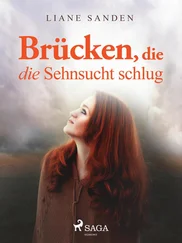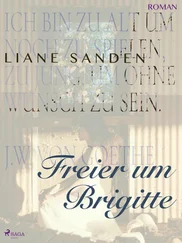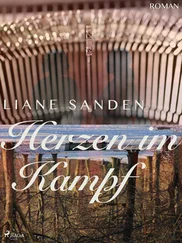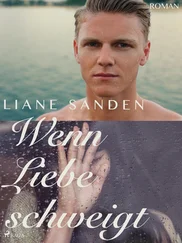Mühlensiefen beobachtete, wie ein Kollege einen anderen fragte: „kommen Sie mit? Ich will mit dem dreizehner Zug fahren.“
Und der andere hatte ohne aufzublicken gesagt:
„Nein, ich habe noch ein bis zwei Stunden zu tun.“
Und was Mühlensiefen dabei am meisten gewundert hatte, das schien den anderen Herren so selbstverständlich, dass man sich gar nicht weiter darum gekümmert hatte.
Auch das Verhältnis der männlichen Angestellten zu den jungen Mädchen setzte Mühlensiefen in Erstaunen. Es waren hübsche Mädels darunter. Auch solche, die sicher einem kleinen Flirt nicht abgeneigt waren. Dr. Heinz Mühlensiefen verstand sich darauf. Aber nirgends hatte er etwas anderes beobachten können, als Kameradschaft, unbefangenes Zusammenarbeiten von Menschen, die an der gleichen Sache wirkten. Dass die technischen Einrichtungen der Werffenwerke geradezu vorbildlich waren, war Mühlensiefen schon in den ersten Stunden aufgefallen. Aber dass auch die Menschen so stark von dem Werk beeinflusst wurden, das wollte Mühlensiefen nicht in den Kopf.
„Schön dumm“, hatte Heinz Mühlensiefen gedacht. „Wie die sich alle von dem Begriff Werffenwerk einfangen lassen. Das könnte mir nicht passieren.“ Und dann fühlte er, wie ihm die Schamröte ins Gesicht stieg. Hatte er, Dr. Heinz Mühlensiefen, sich nicht in diesem Augenblick zu der Auffassung bekannt, derwegen er immer auf die „kleinen Angestellten“ herabgesehen hatte?
Mühlensiefen versuchte vergeblich sich von dem Einfluss frei zu machen, den die Werffenwerke auch auf ihn übten. Und er beschloss einmal zu ergründen, worin dieser Zauber lag.
Er arbeitete nun schon mehrere Wochen in den Werffenwerken. Er betrachtete seine Tätigkeit als die eines Volontärs, der zu seiner weiteren Ausbildung sich im Werk etwas umzusehen hatte. Seinem klugen Blick entging es nicht, dass die Werffenwerke vorbildlich eingerichtet waren und arbeiteten. Jeder Mensch stand hier an seinem Platze. Jeder Mensch leistete Gutes. Das Arbeitstempo war besonders beschwingt. Aber nicht gehetzt. Allen, vom Direktor herunter bis zum kleinsten Angestellten, sah man an, das Werffenwerk war nicht nur der Brotgeber, sondern auch etwas, dem man sich innerlich verbunden fühlte. Diese Entdeckung beschäftigte Heinz Mühlensiefen. Es gab also Menschen, die eine Sache um ihrer selbst willen taten und liebten. Eigentlich hätte er es all den kleinen Buchhaltern, Hilfschemikern, Laborantinnen und Stenotypistinnen nicht verdenken können, wenn sie gerade nur ihre Pflicht getan hätten. Denn was hatten sie schliesslich für ein Interesse daran, den Gewinn für den Inhaber der Werffenwerke durch ihre eigene erhöhte Arbeit zu steigern? Aber als er einmal die Sozialabteilung kennenlernte, wurde er anderer Meinung. Hier lag der Schlüssel zu der steten Arbeitswilligkeit des Personals und auch der Schlüssel zum Verständnis für die beinahe väterliche Stellung des Geheimrats Werffen zu jedem im Werk. Hier sah Heinz Mühlensiefen zum erstenmal, dass Reichtum auch eine Verpflichtung gegenüber andern bedeutete. Das gab ihm innerlich einen Ruck. Er hatte bisher das Werk seines Vaters nur als Quelle zu einem bequemen, leichtsinnigen Leben betrachtet. Und selbst der Vater, obwohl seinen Angestellten gegenüber von Pflichtbewusstsein erfüllt, tat nicht annähernd das, was hier in den Werffenwerken für die Angestellten geschah. Heinz Mühlensiefen war klug genug, um zu erkennen, dass Wohltun unter Umständen mehr Zinsen tragen könnte als Kapital. Unwillkürlich wurde er von dem freudigen Arbeitseifer hier angesteckt. Und bald war es ihm dank seiner Begabung gelungen, hier und da kleine Verbesserungen vorzuschlagen, die bald in die Praxis umgesetzt wurden. Nach kurzer Zeit schon konnte Geheimrat Werffen dem alten Kommerzienrat Mühlensiefen einen vertraulichen Brief schreiben, in dem er sich in lobenden Worten über die Begabung von Heinz Mühlensiefen äusserte. Der alte Kommerzienrat Mühlensiefen war über diesen Bericht um so erfreuter, als sein Sohn Heinz ihn mit Mitteilungen nicht allzusehr verwöhnte. Vor allen Dingen hätte er gern etwas über den privaten Verkehr seines Jungen bei Werffens gewusst. Aber darüber schwieg sich sowohl Heinz wie der Geheimrat aus. So sandte denn Kommerzienrat Mühlensiefen einen Brief an seinen Sohn, den Heinz eines Morgens erhielt. Nach Mitteilungen über den geschäftlichen Zustand der Fabriken schrieb Kommerzienrat Mühlensiefen:
„Ich bedaure, mein Junge, dass Du Deine mir genügend bekannte Schreibfaulheit immer noch beibehältst. Vor allen Dingen hast Du mir noch gar nichts über Deinen Verkehr bei Werffens berichtet. Vergiss nicht, dass Du als künftiger Inhaber unserer Firma Beziehungen pflegen musst. Du weisst doch, dass ich Veranlassung habe, Geheimrat Werffen besonders dankbar zu sein, der sich in einem kritischen Moment mit dem ganzen Gewicht seiner Person für mich eingesetzt hat. — Wie hat sich denn eigentlich seine Tochter Annelore entwickelt? Ich habe sie als auffallend hübsches Kind in Erinnerung, das mir immer etwas bedrückt schien. Solche Menschen sind für Herzlichkeit doppelt dankbar! Grüsse den Geheimrat und Annelore von mir, wenn Du wieder bei ihnen bist. Mit bestem Gruss
Dein Vater.“
Heut schien es Mühlensiefen im Werk wieder zum Auswachsen langweilig. Missmutig sah er auf die Papiere, die der Prokurist ihm zur Bearbeitung übergeben hatte. Es war eine Rückfrage notwendig. Mühlensiefen wollte sich etwas Abwechslung verschaffen und ging deshalb selbst in die Filmabteilung hinüber, statt einfach zu telefonieren. Im Treppenhaus begegnete er Fränze Müller, seiner netten Bekannten aus der Untergrundbahn. An die hatte er gar nicht mehr gedacht. Das war ein munterer kleiner Kerl. Ein netter Zeitvertreib, solange Lou nicht da war.
„Sehe ich Sie endlich mal wieder, Fräulein Müller? Ich habe mich immerfort schon nach Ihnen umgesehen.“
„Ach, das tut mir aber leid“, sagte Fränze Müller spöttisch lachend. „Dass es solche Einrichtungen wie Post und Fernsprecher gibt, ist Ihnen wohl bisher noch gar nicht aufgefallen, Herr Doktor? Und dass Sie Ihre Wette verloren haben, auch nicht?“
„Um Gottes willen, machen Sie’s nur gnädig. Mit einem armen verlassenen Junggesellen darf man nicht so scharf ins Zeug gehen. Aber ins Kino darf man mit ihm gehen.“
„Darüber liesse sich reden, Herr Doktor. Natürlich nur, wenn Sie versprechen, schön brav zu sein.“
„Unerhört brav, Fräulein Müller. Ich bin bereit es zu beschwören.“
„Nee, schwören Sie lieber nicht. Wohin wollen Sie mich denn einladen?“
„Wohin Sie wollen, wenn wir nur dann noch gemütlich ein Glas Wein trinken gehen.“
„Gegen diese Verbesserung des Abendprogramms habe ich nichts Grundsätzliches einzuwenden. Jetzt muss ich aber weiter.“
„Um 7 Uhr am Alsterpavillon, Fräulein Fränze?“ Vergnügt lächelnd setzte Mühlensiefen seinen Weg fort. Glück gehabt, dachte er. Das Mädel hat etwas Prickelndes an sich. Mosseux? Nein, das war die kleine Müller nicht. Aber ein spritziger, leichter Rheinwein!
*
Seit dem letzten Spaziergang mit ihrem Vetter hatte Annelore Gerhard kaum noch zu Gesicht bekommen. Wenn sie ihn einmal traf, so war er immer, wie er sagte, ausserordentlich mit seiner neuen Erfindung beschäftigt. Er machte dann das sogenannte „Arbeitsgesicht“, wie sie es schon vom Vater her kannte und vor dem sie etwas Bangigkeit empfand. Es war so eine gewisse Falte in der Stirn und ein Abwesendsein, das man selbst unter der Liebenswürdigkeit sehr deutlich spürte. Da war es besser, Gerhard nicht mit sich selbst zu belästigen. Man konnte ihm ja auch nicht viel sagen. Denn diese eigentümliche Befangenheit ihm gegenüber wuchs mehr und mehr. Dazu kam ein gewisses Trotzgefühl. Wenn eben Gerhard um seiner Arbeit willen alles andere vergass und gar nicht mehr daran dachte, ob sie ihn brauchte oder nicht, dann wollte sie sich ihm nicht aufdrängen. Aber weh tat es, sehr weh! Wie allein sie doch war!
Читать дальше