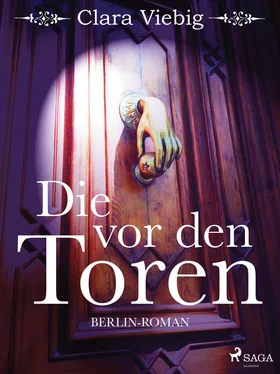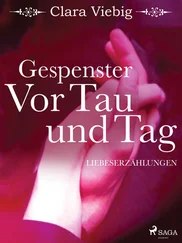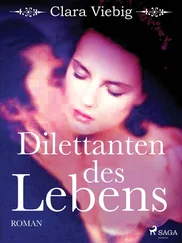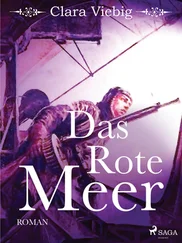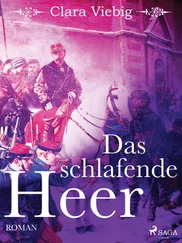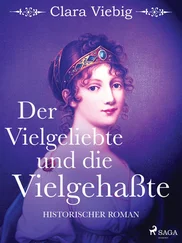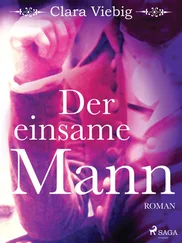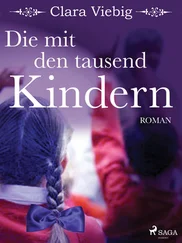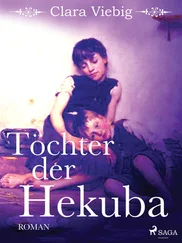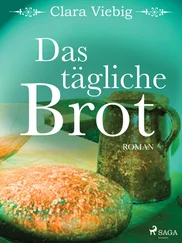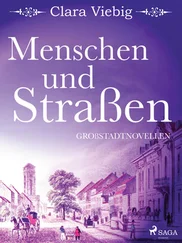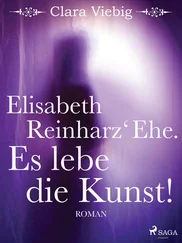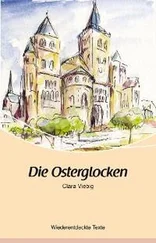*
Es war ein Jammer mit Mieke, sie trieben alle ihren Spaß mit ihr, aber sie merkte es nicht. Im Gegenteil, sie war sehr stolz darauf: seit sie im Frühsommer mit Bauer Brenneke auf den Acker gefahren war, waren ja alle wie toll auf sie. Das machte sie glückselig. Wenn die jungen Burschen sich nach ihr umsahen, wenn die Männer sogar ihr zublinkten, oder ihr beim Vorübergehen ein Wort, das nicht gerade fein war, zugeraunt wurde, dann drehte sie sich und schwänzelte. Der Mutter lag sie jetzt in den Ohren, sie wollte zum Geburtstag ein rosa Kleid haben – was sollte sie noch länger in Trauer gehen um den toten Bruder?!
Auch Auguste putzte sich, besonders wenn sie in die Klavierstunde nach Berlin fuhr. Und sie fuhr häufig. Die Lehrerin hatte gesagt, sie solle jetzt lieber dreimal als einmal die Woche kommen. Wollte sie denn ein Klavierfräulein werden, so eine, die sich damit ihr Brot verdiente, daß sie ihre Finger wie Ratten im Schafstall auf dem Klimperkasten herumrennen ließ?! Mutter Badekow schüttelte den Kopf: „Det hast du doch nich nötig, Juste!“
Aber Auguste war gekränkt, ihre Augen füllten sich mit Tränen: also auch dieses Einzige wollte man ihr nehmen? Was hatte sie denn sonst? Die anderen Mädchen im Dorf, mit denen sie in der Schule gesessen hatte, waren längst verheiratet. Mit achtzehn Jahren schon hatte Miene Kiekebusch den Bierbrauer gekriegt, und Trudchen Hahnemann heiratete mit neunzehn; keine war viel über zwanzig gewesen! Auguste wurde ordentlich grob; sie, die sich sonst nie ein Wort gegen die Mutter getraut hatte, stieß jetzt unter zornigen Tränen heraus: „Was weißt du, wie mir zumute is! Ach, ich bin so unglücklich!“ Sie weinte herzbrechend.
„Mutter, das kannste mir jlauben“, sagte Johann, dem die Badekow klagte, „sie is nur so verrückt, weil sie den Windhund, den Paschke, immer noch im Kopf hat. Mit mir mault se auch. Einmal habe ich den Kerl schon rausjeschmissen – er kann sich noch ’n zweites Mal die Türe von außen besehen!“ Der sonst so ruhige Mann redete sich ordentlich in Wut.
„Jawoll“, sagte Hanne Badekow und legte ihrem Ältesten die Hand auf den Joppenärmel, „recht haste, et is ’ne Ausverschämtheit von son’n Menschen, um Aujusten anzuhalten. Aber det se nu tück’sch is, det versteh ick ooch; un et jrämt mir. Die Jrete, deine Frau, hat schonst Zwillinge, un is noch zwei Jahre jünger wie Juste. Kuck dir mal det Mächen jenau an: janz jrau un kritzig sieht se aus!“ Die Mutter seufzte: „Man will doch weiter nischt, als seine Kinder jlücklich machen, aber et scheint, wie man’t macht, macht man’t verkehrt. Seit ich Justen die vielen Klavierstunden jeben lasse, is et jar nich mehr mit sie auszukommen!“
„Mit ihr auszukommen“, verbesserte der Sohn.
„Na ja, mit ihr auszukommen!“ Die Badekow wurde ärgerlich. „Fängste ooch so an? Der Jakob, seit der den jroßen Laden in Berlin hat, verbessert er mir ooch immer; un ick sage“ – sie schlug sich auf die Brust –, „wenn man hier det olle Herz richtig spricht, uf det andere kommt et nich an!“
„Da haste recht!“ Johann war ganz beschämt; herzlich faßte er die Mutter um: „Sei man nich böse, Mutterken!“
„I wo!“ Sie war nicht empfindlich. „Aber um wieder auf Aujusten zu kommen – die janze Nacht habe ick destowegen nich schlafen können –, sie wird ’n doch nich treffen, wenn se nach Klavierstunde jeht? Sie bleibt immer so lange!“
„Donnerwetter!“ Johann sah betroffen aus, aber dann schüttelte er den Kopf: „Nee, Mutter, das redste dir ein, so runter jibt sich Aujuste nich. Was wohl Jrete zu meint?“ Er wollte zur Tür.
Aber die Mutter hielt ihn fest. „Nee, nee, laß man! Wenn se ooch deine Frau is – – ’ne jute Frau, – se is aber doch ’ne Schellnack. Wat ick so mit dir spreche über Aujusten, und – und – na, überhaupt so über unsere Familie, det bleibt unter uns Badekows!“
Johann nickte zustimmend; er verstand das vollkommen.
„Und denn, Johann“ – die Mutter sprach mit gedämpfter Stimme –, „denn muß ick dir ersuchen, mir zum Ersten fünfdausend Daler flüssig zu machen. Ick habe ja keen Jeld bar zu liegen.“
„Wozu brauchste se denn?“
„Ick – ick brauche se.“ Sie zögerte, aber dann sagte sie entschlossen: „Ick will se Jakob’n jeben!“
„Jakob jeben – schon wieder? Kommt der schon wieder und bettelt dich an?!“
„Jestern war er da“, sagte sie. Und dann leise, wie bittend: „Wat kann er dafür, wenn ihm ’ne Hypothek jekündigt is? Er find’t so rasch keene andre nich!“
„Ach was, das red’t er dir vor. So ’ne lumpige Hypothek. Wenn er nich faul stände, kriegte er sofort überall die paar Tausend. Ein Badekow! Und bei dem Geld, was wir noch mal von dir erben! Aber er is eben ’n fauler Kopp!“ Johann kochte innerlich. Natürlich, so war die Mutter immer; wenn Jakob kam und Geld verlangte, dann gab sie. Wo sollte das noch hin? Was hatte der Jakob schon alles geschluckt! Zehn Berufe hatte er gewechselt, zuletzt war er auf dem Kaufmann hängen geblieben. Die Mutter mußte man zurückhalten ihm gegenüber. „Wenn wir nu alle so sein wollten!“ Er sagte es vorwurfsvoll. „Wir haben doch alle jleiches Recht!“
„Wartet man ab!“ Sie sagte es ohne jede Ärgerlichkeit; es war ja ganz selbstverständlich, daß Johann auf ihr Erbe rechnete. Die Kinder hatten nur jedes dreißigtausend Taler, den ganzen großen Rest aber sie. Uneingeschränkt. „Vor der Hand biste noch nicht in Verlejenheit, du hast jut jeheirat’t, du kannst et abwarten. Un wenn de vielleicht meinst, ick schenke Jakob’n wat, denn irrste dir. Et wird ihm abjezogen bei Heller un Pfennig. Ick habe euch alle jleich lieb. Wat Jakob jetzt verbraucht, kann er später nich erben, aber – laß mir die Freude, ihm schon jetzt wat zu jeben. Nachher sehe ick ja doch nischt mehr von!“
Da konnte Johann ihr wiederum nicht unrecht geben, wenigstens nicht ganz. Sie einigten sich immer. Sie wußten beide das Geld zu schätzen und hielten es fest, – Johann war noch mit seiner Mutter auf den Wochenmarkt gefahren und schätzte den Wert des Sechsers – aber er war auch ein Badekow und sah es ein, daß die Mutter den Jakob nicht im Stich lassen konnte.
Es ging das Gerücht um, eine englische Terraingesellschaft würde das Rittergut Tempelhof, den früheren Besitz der Templer, den Templer Hof, käuflich erwerben. Überall im Dorfe wurde diese Neuigkeit besprochen. Oho, die waren mehr als schlau, diese Engländer, diese Pfeffersäcke! Kauften guten märkischen Boden, um ihn dann in Stücke und Stückchen auseinanderzureißen, je nach Bedarf, und ihn zu „verkloppen“ an Gott weiß wen und zu Gott weiß was für Zwecken!
Man war aufgeregt, fast empört über den jetzigen Besitzer, der solch einen Schacher trieb!
In Kiekebuschs Gastwirtschaft wurde die Sache lebhaft besprochen. Bis unter die Dorflinden schallte, trotz der geschlossenen Fenster, der hitzige Diskurs: wieviel zahlten die Kerls? Für viermalhunderttausend Taler hatte seinerzeit der Graf den Templer Hof an den Bankier verkauft, aber der würde jetzt erheblich mehr herausschinden. Das Gut war auch mehr wert – überhaupt jetzt nach dem Krieg! Jetzt war Geld ins Land gekommen; das rollte. Donnerwetter, fünf Milliarden! Überall Millionenregen. Davon konnte, wollte und mußte jeder profitieren. Tempelhof hatte lange genug schlechte Zeiten gehabt. Wie hatte es noch vor fünfzig Jahren hier ausgesehen! Erst nach den großen Bränden der zwanziger Jahre waren die Strohdächer verschwunden, und es war anständig gedeckt worden; nur die alte Badekowsche Scheune hatte noch Stroh. Aber wenn die alte Badekow erst das Zeitliche gesegnet hatte, dann würde der Johann auch gleich neu bauen.
Warum sollte die alte Scheune weg? Die hatte zwar nur Lehmwände, aber sie stand noch lange fest; früher baute man solider. Großvater Schellnack, ein Mann in den Achtzigern, redete für die Scheune. Nicht nur, weil seine Enkelin Grete den Johann Badekow geheiratet, und weil schon seit ein paar Jahrhunderten Badekowsches und Schellnacksches Blut sich vermengt hatten: er hielt was darauf, daß man einem Dorf anmerkte, daß es eine Vergangenheit hatte. Oho, Tempelhof konnte noch lange mit Berlin konkurrieren!
Читать дальше