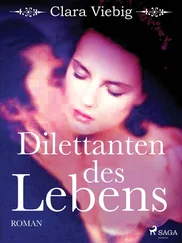Clara Viebig
Die vor den toren
Saga
Die Längnicks, die Badekows und die Schellnacks waren die reichsten in Tempelhof. Die Lietzows hatten aber auch Geld, besonders Gottfried stand sich gut, nicht bloß weil er seine Cousine, Lene Badekow, zur Frau hatte, sondern auch, weil er es verstand, die Handelsgärtnerei, die Spargelkultur, den Obstbau, die Hühnerzucht, die Milchwirtschaft und noch manches andre so schwunghaft weiter zu betreiben, wie es sein Vater, der alte Lietzow, angefangen hatte.
„Mistfink“ sagte zwar sein Bruder Karl, der Kaufmann, von ihm; und Karls Frau, die hübsche Ida, zuckte die vollen Schultern, wenn von Gottfried die Rede war. Sie rümpfte die Nase: Kleinigkeitskrämer! Wie konnte man sich nur um ein paar Groschen so abrackern?! Aber im Grunde ärgerte sie sich, daß ihre Schwägerin Lene immer vergnügt aussah. Und Karl ärgerte sich auch, wenn er vor seiner Ladentür stand, die sehr bescheidene Auslage im Fenster musterte – ein bißchen Reis, ein bißchen Mehl, ein bißchen Kaffee, ein ewiger Zuckerhut, dessen blaues Papier schwärzlichen Fliegenschmutz zeigte – und wenn er dann sah, wie drüben, jenseits der Lindenreihe, vor dem langgestreckten Haus des Bruders die Karren hielten, welche Kartoffeln, Obst, Gemüse nach Berlin fuhren, und wie die Händler kamen und gingen und wie dem Gottfried, der in hohen Transtiefeln, die Hände in den Hosentaschen, draußen herumstand und dem Aufladen zusah, das Geld nur so zuströmte. Wenn Karl auch die Schankgerechtigkeit neben seinem Ladengeschäft hatte und in der Hinterstube immer Ackerknechte und Fuhrleute, besonders die Hauderer a) saßen, die aus Britz und Mariendorf nach Berlin wollten, Leute, die ganz ordentlich was durch die Gurgel jagten, es kam doch nichts Rechtes dabei heraus. Und die feinste Kundschaft war es auch nicht. Die Ansässigen gingen alle zu Kiekebusch. Als ob es da etwas Besseres zu trinken gäbe! Aber die Tempelhofer waren nun einmal so: wie die Ochsen, immer an die altgewohnte Krippe.
Die Gastwirtschaft von Kiekebusch war der frühere Erbpachtkrug, in dem schon vor hundert und hundert Jahren die Tempelhofer sich betrunken hatten; in dem schon die alten Sünder, die Ordensritter, es nicht verschmäht hatten, einen Trunk zu nehmen, wenn sie von ihrer Burg durch den unterirdischen Gang, der im tiefen Keller des Krugs einen Ausweg hatte, zu ihren heimlichen Liebchen im Dorfe schlichen.
Karl Lietzow hatte als junger Mensch eine Berlinerin zur Frau gehabt. Als diese im Wochenbett gestorben war, hatte er sich wieder in ein Mädchen aus der Stadt verliebt; er war nun einmal an das Städtische gewöhnt. Geld hatte die hübsche Ida keines gehabt, aber sie hatte schöne braune Augen, und die waren im Laden und besonders im Ausschank ebenso viel wert wie Geld. Sie selber empfand es nicht drückend, daß sie keinen Pfennig hatte, nicht einmal eine Aussteuer; da war ja noch genug von der vermögenden ersten Frau da. Deren Röcke und Hemden paßten ihr, in die Betten legte sie sich; sie nahm alles an sich. Sie, die an nichts gewöhnt war, fand Karl Lietzow sehr reich. Es konnte ja gar nicht alle werden, und es wäre geradezu lächerlich, wenn man jeden Groschen zweimal umdrehen wollte.
Ida ärgerte sich, als sie am Morgen des Truppeneinzuges die Lietzows den Break b) besteigen sah. Karl und sie wollten auch hin und den Einzug sehen, es war ein weiter Weg, das Feld war staubig, die Sonne heiß; war es nicht unerhört, daß Gottfried sie nicht aufgefordert hatte, mitzufahren? Bei solchen Gelegenheiten erinnerte man sich doch der Verwandtschaft.
„Na, er muß doch die Badekows fahren, und denn is die Fuhre ja schon mehr als voll“, versuchte Karl den Bruder zu entschuldigen.
Da sah sie ihn so kalt an mit ihren braunen Augen, so fast verächtlich, daß er nicht Lust hatte, noch ein Wort zu reden. Sie sagte auch nichts mehr. Sie sagte überhaupt nie etwas, wenn sie recht böse war. Wenn die Wut in ihr kochte, und die kochte leicht, dann kniff sie nur den Mund zusammen, daß die vollen Lippen ganz schmal wurden und über den Glanz ihrer Augen, über das ganze rosige Gesicht sich ein bleicher Schleier legte. –
Es war spät, als Karl Lietzows zum Einzug gingen.
Tempelhof war wie ausgestorben; alle waren längst fort, nur Hühner scharrten im tiefen, grauen Sand vor den Häusern, und in der Mitte der breiten Dorfstraße, wo die alten Linden stehen, watschelten Enten und schnatterten Gänse über den abgerupften berasten Grund. Die Linden blühten schon. In der warmen Sonne hatten sich alle die goldenen Büschel geöffnet, Bienen umschwärmten sie mit einem Gesumm, das laut wirkte in der großen Stille.
Hinter Zäunen lagen die niedrigen Häuser recht gemütlich mit ihren schmalen Eingängen, die noch schmaler erschienen gegen das breite Hoftor nebenan, durch das morgens die Milchkarren rasselten, im Herbst die Erntewagen ratterten; das ganze Getriebe der Ackerwirtschaft aus- und einrollte. Um die weit übergebauten Türen der Wohnhäuser rankten blühende Jelängerjelieber und halbwilde Rosen, und grüne Bänke standen darunter. Der Flur war freilich dadurch so verdunkelt, daß man, wenn man für gewöhnlich dort saß, eigentlich nur durch den Geruch wahrnehmen konnte, was man auf dem Teller hatte. Aber es saß sich an Sommerabenden angenehm unter den überbauten Eingängen, wenn der Staub sich verzogen hatte, den die in die Ställe heimkehrenden Schafe zu Wolken aufwirbelten, wenn die Blumen auf dem schmalen Gartenstrich zwischen Haus und Straße ihre betauten Köpfe senkten und die Grillen in den alten Mauern zirpten. Und zur Zeit der Lindenblüte ging dann ein Duften aus von den Dorflinden, fremdartig-süß und doch wieder heimatlich-vertraut, ein Duft, sanft und kraftvoll zugleich, der sich mischte mit dem erdigen Geruch der Gemüsegärten, der nährenden Felder und mit dem starken Dampf des warmen Mistes, der aus dem Viereck der Höfe, aus den großen Ställen und Scheunen hinter den kleinen Wohnhäusern aufstieg.
Pfui, wie das stank! Ida Lietzow hatte sich noch immer nicht an das „Tempelhofer Parfüm“, wie sie es nannte, gewöhnen können. Pfui, und der Staub! Man watete wie durch graues Mehl. Verdrossen schleifte im Sonnenbrand Ida ihr langes Kleid neben ihrem Mann her.
Unabsehbar dehnte sich das Feld. Sie gingen jetzt auf der Chaussee mitten hindurch, aber rechts und links war kein Ende zu entdecken. Heute liefen zwar Menschen genug hier herum, aus weiter Ferne gesehen wie Ameisen. Aber die Öde blieb doch, wenn da auch Menschen waren, unzählige vielleicht, aber sie verhallten ohne Laut in der unermeßlichen Weite.
Ida hatte sich das Tempelhofer Feld ganz anders vorgestellt, als sie es nur vom Hörensagen kannte: Paraden, Musik, Wettrennen, schöne Offiziere, schneidige Reiter, mutige Pferde. Aber dünnes, zertrampeltes, mottenfräßiges Gras, hier und da ein Pfuhl in umbuschter Kuhle, das war das Tempelhofer Feld. Sie schüttelte sich. Wenn wenigstens ein paar Häuser hier ständen, daß man doch ohne Furcht gehen könnte! So war man ganz abgeschnitten von Berlin. Alle Stunden zwar sollte der Omnibus fahren von ‚Unter den Linden’ bis Tempelhof, aber nur im Sommer fuhr er stündlich. Mit scheuen Blicken sah die Frau sich um: huh, hier möchte sie um keinen Preis gehen, wenn es dämmerte! –
Sie waren zu spät aufgebrochen, Ida hatte gerade im letzten Augenblick noch etwas zu besorgen gehabt, was sie vergessen hatte schon seit acht Tagen. Die Truppen marschierten bereits vom abgesteckten Gelände hinein in die Stadt. Es war nicht durchzukommen; sie mußten warten. Ida gähnte abgespannt. Mit einem Seufzer setzte sie sich an den Chausseerand, ließ die Füße in den Graben hängen und lehnte Rücken und Kopf an eine Pappel. Die Sonne blendete, man erstickte fast von dem Staub, den Füße und Hufe aufgewirbelt hatten zu einer dunstigen Wolke. Die junge Frau drückte die Augen zu. Hinter ihren geschlossenen Lidern blitzten allerlei Gedanken auf, Wünsche und Träume jagten sich. Sie hörte die Militärmusik, das Brausen der großen Menge, der Welt und der Stadt, und sie riß plötzlich die Augen weit auf – ach, was lag da nicht alles jenseits des verwünschten Feldes! –
Читать дальше