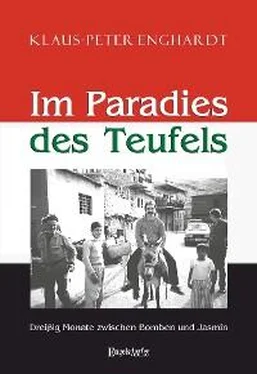Wenn man bereits im Inneren des Flughafens reichlich Anlass zum Staunen hatte, setzte sich das auch im Außenbereich fort.
Dort waren Landschaftsgestalter am Werk, die ihr Handwerk ausgezeichnet verstanden. Neben vielen Bepflanzungen mit den herrlichsten Gewächsen hatten die Gärtner auf dem gesamten Arial hunderte ausgewachsener Palmen eingesetzt.
Bei der Abfahrt vom Flughafen unterfuhr man Brücken, über die riesige Jets zur Abfertigung rollten, es war ein grandioser Anblick und zum ersten Mal sah ich eine Boeing 767 aus nächster Nähe.
Vom Flughafen wäre es gar nicht weit bis zu unserem Camp gewesen, aber wir mussten ja erst zum Passtausch.
An jenem Abend wusste ich allerdings, wohin ich anschließend fahren musste und das gab mir ein beruhigendes Gefühl.
Nach dem Passtausch und der Einteilung der Leute auf die jeweiligen Baustellen fuhren wir nämlich noch in jener Nacht in unsere Unterkunft zum Zentrallager.
Ein paar Kilometer, bevor man von der Hauptstraße zum Camp abbog, fuhr man an einem kleinen Dorf vorbei. Dieses Dorf machte einen halbfertigen Eindruck, da sich die meisten Häuser noch im Rohbau befanden. Es war ein Dorf, wie man sie sehr oft im Irak vorfand, mit denen Saddam Hussein versuchte, das Nomadisieren abzuschaffen und die Beduinen zu zentralisieren. Dazu wurden außerhalb der Städte Siedlungen im Rohbau errichtet und an die Nomadenfamilien übergeben. Für den Ausbau der Häuser mussten die Familien selbst sorgen. Einige Familien machten dann auch recht ordentliche Anwesen daraus, aber bereits in Abu Ghraib hatte ich mehrfach gesehen, dass auch Familien in den Häusern wohnten, ohne dass Fenster oder Türen eingebaut waren. Sie bereiteten ihr Essen sogar am offenen Feuer im Inneren der Häuser. An den Wänden hingen Teppiche und die Bewohner hatten die Häuser wie Beduinenzelte ausgestattet.
Es war eben nicht unkompliziert, jahrhundertelange Tradition in kurzer Zeit abzuschaffen. Da diese Familien von der Schafzucht lebten und mit ihren Herden durch das Land zogen, wurde ihnen in diesen Ansiedlungen die Möglichkeit entzogen, sich auf traditionelle Weise zu ernähren. Ackerbau war ihnen fremd, außerdem war das Land zumeist so karg, dass kaum Erträge möglich waren.
Am Dorfrand standen Schafherden, doch die Tiere waren sehr mager, da es kaum Grasland für alle Tiere gab. Und so mussten die Bewohner notgedrungen andere Erwerbsmöglichkeiten finden, um ihre Familien zu ernähren. Es war deshalb nicht verwunderlich, dass in diesen Dörfern, am Rand der Gesellschaft, der Handel mit allen möglichen Waren blühte, die allerdings meist von minderer Qualität oder illegal erworben waren.
Anders als auf den Basaren in den Städten handelten die Bewohner dieser Siedlungen mit Bier, und zwar mit Dosenbier, jedoch zu unverschämten Überpreisen. Aus welchen Quellen das Bier kam, war mir ein Rätsel, wahrscheinlich war es Schmuggelware aus Syrien, Jordanien oder der Türkei. Der Preis war dabei wohl dem Risiko geschuldet, Handel mit Alkohol außerhalb von kontrollierten Gaststätten zu treiben.
Unter den Monteuren machte im Zusammenhang mit jenem Dorf indes ein Gerücht die Runde, das zwar bisher unbewiesen war, jedoch nie verstummte.
Man erzählte sich nämlich, dass eine weitere Einnahmequelle, und die weitaus Einträglichere für die Menschen in diesen Siedlungen, die Existenz von einer Art „Peepshow“ war, die es in fast jedem Haus geben sollte.
Mädchen und junge Frauen zeigten den Ausländern angeblich in einem separaten Raum des Hauses für ein paar Dinare ihre Körper. Dazu wurden im Halbrund Stühle aufgebaut und das jeweilige Mädchen zog sich dann vor den Männern aus, die wie gierige Wölfe vor einem Kaninchen hockten.
Das war zwar entwürdigend, aber für diese Menschen eine Möglichkeit, ein wenig Geld zu verdienen und daher nahmen sie diesen Umstand auch sehr gelassen hin. Während die Mädchen im Inneren des Hauses ihren Körper zur Schau stellten, saß der Rest der Familie vor dem Haus.
Vater, Mutter, Brüder und Schwestern warteten darauf, wie viele Dinare das Mädchen inzwischen verdient hatte.
Bevor man jedoch das Haus betrat, musste jeder Gast eine Dose Bier für einen Dinar oder gar einen Dinar und einen Quarter kaufen. Ohne Bier wurde der Zutritt verwehrt.
Im Haus wurde dann noch ein weiterer Dinar abverlangt, wenn man dem Mädchen zuschauen wollte.
Für zehn Dinare waren die Mädchen bereit, sich anschließend einem Mann hinzugeben, so jedenfalls erzählten es sich die Monteure im Camp.
Bisher hatte ich allerdings noch keinen Monteur getroffen, der aus eigener Erfahrung darüber sprechen konnte, also musste ich den Gerüchten so lange Glauben schenken, bis es zu einem Beweis kommen würde.
Inzwischen waren wir im Camp angekommen. Es war fast vier Uhr morgens und ich hatte Mühe, meine Augen offen zu halten.
Zunächst mussten wir aber noch das mitgebrachte Fleisch in der Küche abliefern. Zum Duschen war ich zu dieser Stunde allerdings zu müde und so wurde nur eine „Katzenwäsche“ abgehalten und das Gepäck verstaut.
Ich war inzwischen vierundzwanzig Stunden auf den Beinen und physisch völlig ausgelaugt. Glücklicherweise konnte ich ausschlafen, ehe ich die nächsten zehn Wochen in Angriff nahm.
Mein erster Arbeitstag nach dem Urlaub bescherte mir einige neue ägyptische Arbeitskräfte, die ich einarbeiten musste. Darunter befanden sich auch ein Vater und sein Sohn. Der Vater hieß Mutawa, der Sohn Ali. Der Vater hatte eine starke Sehschwäche, trug aber trotz seines Handicaps keine Brille. Er wurde von allen Monteuren „der Blinde“ genannt. Das war nicht böse gemeint und wurde von Mutawa auch nicht übel genommen.
Mir war allerdings schleierhaft, wer den Vater eingestellt hatte, denn derjenige musste auch blind gewesen sein.
Mutawa hatte den Intelligenzgrad eines Kleinkindes, man musste ihm jede Arbeit ellenlang erklären. Meist war es dann immer noch falsch und das kostete Nerven.
Allerdings war der Mann sehr gutmütig. Ich suchte für ihn also Arbeiten aus, die niemand gern erledigen wollte und bei denen es nicht viel falsch zu machen gab, zum Beispiel Schrauben und Muttern einsammeln und sortieren, die entweder beim Montieren heruntergefallen waren oder aus defekten Collies fielen. Diese Arbeit verrichtete Mutawa mit Inbrunst, stets trug er leere Schraubensäcke mit sich herum, in die er die verschiedenen Teile hineinsortierte. Die Säcke hängte er an einen Schaufelstiel, den er dann über seiner Schulter trug.
Bevor er in unserer Firma zu arbeiten begann, war er bereits ein Jahr bei anderen Firmen im Irak tätig und trug seitdem sein gesamtes gespartes Geld in einem Brustbeutel mit sich herum. Ein paar Mal sahen wir ihn in irgendeiner Ecke stehen und sein Geld zählen. Immer wieder blickte er sich dabei um, ob er auch unbeobachtet war, doch er ahnte nicht, wie viele Augen ihn beim Geldzählen verfolgten.
Zunächst amüsierten wir uns noch über seine Marotte, aber schließlich warnten wir ihn doch eindringlich, sein Geld nicht mit sich herumzutragen, sondern es auf eine Bank in Ägypten zu überweisen, doch davon wollte er nichts hören.
Mutawa machte mit Vorliebe kleine Geschäfte mit den deutschen Monteuren. Dabei kaufte er Socken, Unterwäsche, Hemden und andere Dinge von ihnen und verscherbelte die Sachen dann an seine ägyptischen Arbeitskollegen weiter. Besonders gute Geschäfte konnte er abschließen, wenn ein Monteur in den Urlaub flog oder gar seine Endausreise machte und froh war, die ganzen Sachen, die sich im Laufe der Monate oder gar Jahre angesammelt hatten, nicht wieder mit nach Hause nehmen zu müssen. Ganz besonders wild war Mutawa nach Taschenuhren.
Die meisten Monteure trugen diese Uhren am Arbeitsplatz, weil Armbanduhren während der Arbeit unbequem waren.
Jedem Monteur ging Mutawa auf die Nerven, ihm doch seine Uhr zu überlassen, vor allem, wenn er wusste, das der Monteur in der nächsten Zeit nach Hause fuhr.
Читать дальше