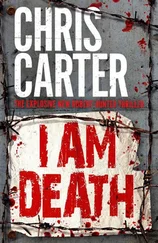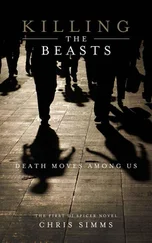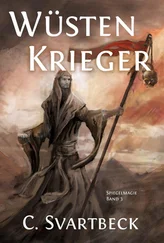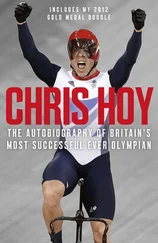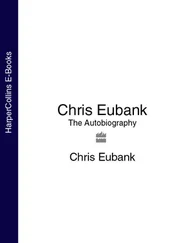Sirit neigte zustimmend das Haupt. Sie konnte sich denken, wie schwer der Ersten Gemahlin diese Worte gefallen waren. Aber die junge Frau hatte einen scharfen Verstand bewiesen. Sie wusste, wo sie Verbündete fand. Sirit würde ihrerseits zusehen, dass sie es Fabriele leicht machte und sich möglichst selten direkt bei ihr blicken ließ.
De facto änderte sich also nichts, auch wenn Fabriele jetzt offiziell die Erste Frau im Sommerharem war. Nur dass Sirit im Gegensatz zu den meisten früheren Königswitwen nicht im Winterharem verschwand, auch wenn sie sich dort vorsorglich einen weiteren Wohnsitz eingerichtet hatte, in den sie sich manchmal zurückzog.
Die Diener wussten anfangs nicht so recht, was sie davon halten sollten, stellten es aber nicht infrage. Es stand ihnen nicht zu, das Verhalten der Königlichen zu kritisieren.
Inagoro begrüßte es. Zum einen wusste er, dass seine Mutter ohnehin Mittel und Wege gefunden hätte, sich auch weiterhin überall einzumischen, zum anderen bereitete es ihm eine grimmige Freude, zu sehen, wie der Thronrat auf Sirits wiederholtes Auftauchen reagierte.
Noch jemand schien sich zu freuen. Sirit bekam erneut eine Blumenschale, dieses Mal mit Herzblättern. Der traditionelle tolorische Glückwunsch zur erfolgreichen Geburt eines gesunden Stammhalters. Sie tauchte verzückt ihre Nase in den würzigen Duft. Wann hatte sie das letzte Mal Herzblätter gerochen? Damals war ihr kleiner Bruder Pino geboren worden, und die Herzblätter hatte die Wöchnerinnenstube ihrer Mutter fast in eine grüne Wiese verwandelt.
Ihre jüngste Zofe Visari war geradezu entzückt, als sie die frischen Herzblätter roch. Kein Wunder, das Mädchen kam aus dem Norden und war vermutlich, ähnlich wie Sirit, der stickig-süßlichen Gerüche Sawateenataris herzlich überdrüssig. „Es wäre schön, wenn es hier mehr Dinge gäbe, die so herrlich frisch riechen“, bemerkte sie.
Sirit stellte auch diese Blumenschale auf das inzwischen recht volle große Tablett, zu den anderen Bergblumen, die in der künstlichen Kühle des Zaubers niemals zu welken schienen. Wer immer ihr diese Blumen schickte, er wusste, dass ein Teil ihres Herzens in Tolor geblieben war.
„Die Mutter des Königs hat schon wieder hinter dem Wandschirm gesessen. Oh, sie hat keinen Laut von sich gegeben, man hat keine Bewegung gesehen, aber ihr Sohn hat zwei- dreimal dorthin gesehen. Und die Wachen haben gesagt, sie sei hinterher bei ihm gewesen und habe mit ihm gesprochen. Und was immer sie gesagt hat, wir haben den Steuererlass danach jedenfalls nicht mehr durchbekommen.“
„Verdammte tolorische Berghexe. Kanata hätte seine Finger von den Bergen lassen sollen. Diese nutzlose Alte ist nicht einmal zivilisiert genug, um sich in den Winterharem zurückzuziehen.“
„Kunststück. Der König hat ja auch keine Erste Gemahlin aus dem Hochadel. Hätte er eine solche, wäre die Tolorierin längst an ihren Platz verwiesen worden. Aber so … Erst diese unzumutbaren Frauen aus den Grauen Schluchten, und dann diese Kleine aus niederem Provinzadel vom Grünwassersee.“
„Ganz zu schweigen davon, dass selbst unser König kein reinrassiger Karapakier mehr ist.“
„Gemach, gemach“, bremste Melechko seine illustren Gäste, während er den Sklaven winkte, ihnen erneut Wein einzuschenken. „Wir sind uns doch einig, dass das Königshaus selbst tabu ist. Immerhin wird es nach wie vor von den Priestern und Zauberern gestützt. Aber wer ist jene Stimme, die unserem jungen, unerfahrenen König immer wieder verderbliches Gedankengut einflüstert? Doch nur seine Mutter! Bei ihr müssen wir ansetzen.“
„Und wie? Seit unserem Versuch, seine derzeitige erste Gemahlin unfruchtbar zu halten sind die Wachen und die Kontrollen des Sommerharems verdreifacht worden. Außerdem heißt es, sie könne anderen Menschen böse Gedanken mit ihren Spiegelaugen förmlich ansehen. Wie sollen wir an diese Frau herankommen?“
Melechko schnippte mit den Fingern. Ein Sklave kam herbei, mit unsicherem, taumelnden Gang, in seinen Händen eine brennende Kerze. Die Kerze war schon tief abgebrannt, so tief, dass die Flamme über seinen Daumen leckte. Er schien es nicht zu spüren.
„Was seht Ihr, meine Herren?“
„Einen nutzlosen, kranken Sklaven“, knurrte Herzog Komato.
„Nutzlos mag er jetzt sein, aber krank ist er nicht.“
Komatos Gesicht wurde lauernd. „Weshalb geht er dann so merkwürdig?“
„Taubtod.“
Baron Fikarasi zischte anerkennend. „Teuer.“
„Und wirksam. Die Kerze ist damit imprägniert. Sie hatte eine Brenndauer von fünf kleinen Kerzen. Er hat sie die ganze Zeit gehalten.“
Der Sklave schien jetzt zu merken, dass sein Daumen geröstet wurde. Die Finger zuckten, er öffnete den Mund, als ob er schreien wollte, aber es kam nur ein Röcheln heraus, gefolgt von kurzen, stöhnenden Atemzügen.
„Wie wir alle wissen“, dozierte Melechko, „gibt es gegen Taubtod kein Gegengift. Und der Stoff ist wunderbar hautgängig.“
„Und wie“, fragte Komato spöttisch, „wollt Ihr die Mutter des Königs dazu bringen, stundenlang eine Kerze festzuhalten?“
„Es muss keine Kerze sein. Alles, was diese Flüssigkeit auf oder in ihren Körper bringt, wird funktionieren.“
„Der Sommerharem hat Vorkoster. Solche, die alle Lebensmittel und Getränke bereits bei der Anlieferung probieren, Tage, bevor sie im Harem gegessen werden.“
„Es gibt Dinge, die so harmlos sind, dass sie niemand verdächtigt. Gegenstände, Zutaten, mit denen die Mutter des Königs niemals selbst direkt in Kontakt kommen wird. Aber sie können das Gift weiterreichen an jene Dinge, die sie dann tatsächlich berührt.“
„Hmmm.“ Komato beobachtete den Sklaven, der jetzt seitlich einknickte. Sein Atem war hastiger geworden und gleichzeitig flacher. Er wirkte wie ein Fisch, der in der Luft vergeblich nach Sauerstoff schnappte. „Und das funktioniert sicher?“
„Er ist der Dritte, an dem ich es ausprobiert habe. Es funktioniert immer.“
„Wie lange hat er noch?“
„In dem Zustand? Gut eine kleine Kerze, vielleicht auch anderthalb.“
„Verliert er dabei das Bewusstsein?“
Ein verzerrtes Grinsen entstellte Melechkos Züge. „Oh nein! Das ist ja das Schöne an Taubtod! Man bleibt bei Bewusstsein, kann sich aber nicht mehr bewegen, nicht mehr reden und kaum noch atmen. Man merkt, wie man langsam erstickt.“
Herzog Komato hob sein Glas. „Ihr seid ein Mann mit vortrefflichen Ideen und gutem Wein!“
*
Einer der königlichen Hunde war vergiftet worden. Ausgerechnet die Waschfrauen erfuhren zuerst davon.
„Warum sollte jemand einen Hund töten wollen?“ Mai, die jüngste der Wäscherinnen, hob prüfend den Stoff aus dem Flusswasser. Nein, der Fleck war noch nicht weg. Sie tauchte den Stoff wieder ein und griff erneut zur Bürste.
„Vielleicht war ja gar nicht der Hund das Ziel. Es heißt, die Hunde hätten an dem Tag Reste der königlichen Tafel als Futter bekommen.”
Pashti, eine der älteren Waschfrauen, wedelte mit ihrer Bürste in Richtung Palast. „Der Zwingermeister hat es unter den Tisch gekehrt. Hat so getan, als wäre der Hund an einer Krankheit verreckt. Der junge König ist zwar nicht ganz so jähzornig wie sein Vater, aber er liebt seine Hunde.”
„Aha. Und woher weißt du das dann?”
„Ich habe eine Nichte, die arbeitet im Palast als Wasserträgerin. Und die kennt den Koch, und der hat von Marek, dem Meister der Innenhöfe, gehört, was geschehen ist.”
„Der arme Hund. Kann doch nichts dafür, dass sein Herr der König ist.”
„Besser, ein Hund stirbt, als unser König. Stell dir vor, wenn es den König wirklich erwischt hätte. Seine Söhne sind kleine Kinder. Womöglich hätten wir dann wieder die Mutter des Königs als Regentin!”
Читать дальше