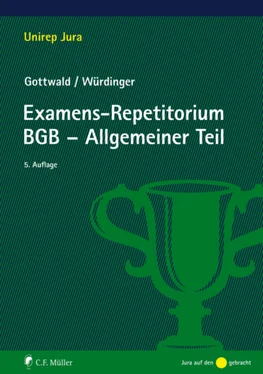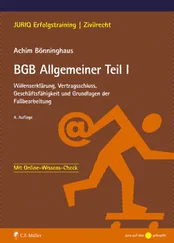2. Rechtsgeschäfte unter Lebenden und von Todes wegen
30
Der Normalfall ist das Rechtsgeschäft unter Lebenden, das sofort, zu einem vereinbarten Zeitpunkt oder bei Bedingungseintritt Rechtswirkungen entfaltet. Den Gegensatz dazu bilden Rechtsgeschäfte von Todes wegen, durch die Anordnungen für den Fall des Todes getroffen werden (Testament, §§ 2064 ff BGB, und Erbvertrag, §§ 2274 ff BGB). Rechtsgeschäfte von Todes wegen binden den Erblasser zu seinen Lebzeiten nicht. Sie hindern ihn also nicht daran, über sein Vermögen zu verfügen (§ 2286 BGB). Abgrenzungsprobleme bestehen bei Schenkungen unter Lebenden auf den Todesfall. Nach § 2301 BGB sollen in diesem Fall die Vorschriften über Verfügungen von Todes wegen Anwendung finden, sofern die Schenkung nicht zu Lebzeiten des Schenkers vollzogen wurde. Ausnahmevon dieser Regel ist die praktisch relevante Zuwendung durch einen echten Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall(§ 331 BGB), etwa die schenkweise Zuwendung einer Lebensversicherungssumme durch einen Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft (§ 159 VVG).[40]
3. Einseitige und zweiseitige Rechtsgeschäfte
31
→ Definition:
Den Regelfall bildet das zweiseitige Rechtsgeschäft, der Vertrag, der durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande kommt. Entsprechend zum Vertrag ist das mehrseitige Rechtsgeschäftzu konstruieren, wenn mehrere Personen daran beteiligt sind. Das einseitige Rechtsgeschäftbenötigt dagegen nur eine einzige Willenserklärung, z.B. die Auslobung (§§ 657 ff BGB), das Testament (§§ 2064 ff BGB), die Erteilung einer Vollmacht (§ 167 BGB) oder einer Verfügungsermächtigung (§ 185 I BGB), die Ausschlagung einer Erbschaft (§ 1945 I BGB), die Ausübung von Gestaltungsrechten wie die Kündigung (z.B. nach § 314 I 1 BGB), die Anfechtung (§ 143 I BGB) oder der Rücktritt vom Vertrag (§ 349 BGB).
32
→ Definition:
Rechtsgeschäftsähnliche Handlungen beruhen auf einer Willensäußerung. Der Unterschied zum Rechtsgeschäft besteht darin, dass das Gesetz hier Rechtsfolgen vorsieht, unabhängig davon, ob sie der Äußernde gewollt hat, wie z.B. bei einer Mahnung (§ 286 I 1 BGB).[41] Auf die rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen sind die Vorschriften über Rechtsgeschäfte analog anzuwenden, soweit es der Zweck und die Eigenart der betreffenden Erklärungen zulassen.[42]
4. Rechtsgeschäftsähnliche Handlungen
a) Einwilligung in Rechts- bzw. Rechtsgutseingriffe
33
Von besonderer Bedeutung ist die Frage, wie die Einwilligung in Rechts- bzw. Rechtsgutseingriffe von ihrer Rechtsnatur her einzuordnen ist und welche Anforderungen an ihre Wirksamkeit zu stellen sind. Sie ist nicht mit einer Einwilligung gemäß §§ 107, 183 S. 1 BGB zu verwechseln, bei der es sich um eine Willenserklärung handelt.[43] Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass der Träger eines Rechts bzw. eines Rechtsguts dessen Beeinträchtigung grundsätzlich gestatten kann. Liegt eine wirksame Einwilligung vor, so ist der Eingriff nicht widerrechtlich i.S.d. § 823 I BGB. Die Möglichkeit der Einwilligung ist u.a. anerkannt bei Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit, das Eigentum, den Besitz, die Bewegungsfreiheit und die verschiedenen Ausprägungen des Persönlichkeitsrechts (disponible Rechtsgüter). Geht es um einen Eingriff in ein vermögenswertes Recht, etwa das Eigentum, so ist § 107 BGB analog heranzuziehen.[44]
34
Eine besondere Bedeutung kommt der Einwilligung und ihrer Wirksamkeit bei medizinischen Behandlungenzu, da Operationen und ähnliche Maßnahmen, die in die Substanz des Körpers eingreifen, nach der Rechtsprechung auch im Zivilrecht den Tatbestand der Körperverletzung erfüllen. Nach § 630d I 1 BGB ist der Behandelnde vor der Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder die Gesundheit, verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Damit soll dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten (Art. 2 I GG iVm Art. 1 I GG) Rechnung getragen werden.[45] Relevant kann die Einwilligung außerdem bei sportlichen Betätigungen mit gegenseitiger Verletzungsgefahr[46] oder Tätowierungen[47] sein. Da es um einen Eingriff in höchstpersönliche Rechtsgüter geht, wird die Einwilligung allgemein nicht den §§ 104, 106 ff BGB unterstellt, vielmehr stattdessen auf die natürliche Fähigkeit abgestellt, Bedeutung, Tragweite und Gefahren zu übersehen und insoweit vernünftig zu entscheiden.[48] Feste Altersgrenzen lassen sich nicht festlegen, da der Entwicklungsstand eines jeden Jugendlichen individuell zu berücksichtigen ist. Es ist jedoch umso eher von einer Einwilligungsfähigkeit auszugehen, je mehr sich der Jugendliche der Grenze der Volljährigkeit nähert.[49] Ist der Rechtsgutsträger zur Willensbildung und -äußerung nicht in der Lage, kommt eine mutmaßliche Einwilligung jedenfalls dann in Betracht, wenn durch eine Untätigkeit das Leben oder die Gesundheit des Rechtsgutsträgers gefährdet würde.[50] Eine Behandlung, für die es auf Grund von Aufklärungsmängeln an einer wirksamen Einwilligung fehlt, kann nach den Grundsätzen der hypothetischen Einwilligung dennoch gerechtfertigt sein, wenn davon auszugehen ist, dass der Rechtsgutsträger auch bei einer ordnungsgemäßen Aufklärung in den Eingriff eingewilligt hätte (siehe auch § 630h II 2 BGB).[51]
35
Willensmängel führen nicht zu einer Anfechtbarkeit gemäß §§ 119 ff BGB, sondern ohne Weiteres zur Unwirksamkeit der Einwilligung. Bei der Einwilligung in eine Operation liegt das Problem vor allem darin, dass ihre wirksame Erteilung eine ausreichende Aufklärung des Patienten über Notwendigkeit und Gefahren des Eingriffs voraussetzt (§ 630e BGB).
36
Fall 7:
Eine Krankenschwester wurde nach einem Beinbruch in einer orthopädischen Klinik behandelt. Dabei erkrankte sie am rechten Auge an Herpes. Der zugezogene Augenarzt verordnete eine Behandlung mit verschiedenen Injektionen. Diese wurden von der Stationsschwester vorgenommen und zwar jeweils in das gesunde Bein oder in das Gesäß. Die letzte Injektion verabreichte die Stationsschwester in das gebrochene Bein. Die Patientin fragte vor der Injektion, warum ihr denn ausgerechnet in das kranke Bein gespritzt werden müsse. Die Stationsschwester antwortete darauf, dass das nichts mache. Die Patientin erlitt im Anschluss an die Injektion eine Entzündung mit Abszessbildung und Nekrosen, in deren Verlauf das linke Bein oberhalb des Knies amputiert werden musste. Sie verlangt nun von dem Krankenhaus Schadensersatz aus § 831 I BGB, weil die Stationsschwester eine eigenmächtige gefährliche Behandlung durchgeführt habe. Zu Recht?[52]
Lösung:Das Krankenhaus könnte nach § 831 I BGB schadensersatzpflichtig sein. Die Stationsschwester ist gegenüber den Ärzten weisungsgebunden und damit Verrichtungsgehilfin. Sie verabreichte die Injektion auch in Ausführung der Verrichtung.
Fraglich ist, ob die Stationsschwester widerrechtlich einen Schaden zugefügt hat, also eine rechtswidrige Handlung i.S.d. § 823 I BGB begangen hat, oder ob das Verhalten der Stationsschwester nicht rechtswidrig war, weil eine entsprechende Einwilligung der Patientin vorlag, § 630d I 1 BGB. Der BGH hat die Einwilligung der Patientin im Einzelnen ausgelegt. Nach seiner Meinung bezog sich die Einwilligung in die Injektionen auf sämtliche geeignete Körperteile. Allerdings habe es der Patientin freigestanden, im Einzelfall zu widersprechen. Mit ihrer Frage habe sie jedoch nicht endgültig widersprochen, sofern sie nicht überrumpelt worden sein sollte. Da die Patientin aber selbst Krankenschwester gewesen sei, habe die Stationsschwester nicht mit einem Einschüchterungseffekt rechnen müssen. Deshalb bleibe nur die Feststellung, dass die Patientin die Injektion zwar widerwillig und zögernd, aber doch im Sinne einer Einwilligung hingenommen habe. Eine andere Auslegung sei mit den Gegebenheiten und Notwendigkeiten des klinischen Betriebs nicht zu vereinbaren. Ängstlichkeit und Wehleidigkeit, die von Patienten sehr häufig geäußert würden, stünden der Wirksamkeit der Einwilligung nicht entgegen. Folglich liegt keine rechtswidrige Handlung vor.
Читать дальше