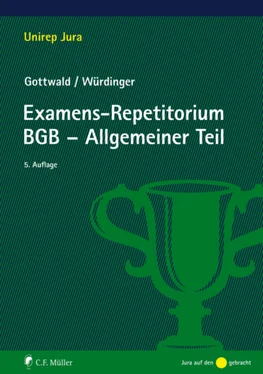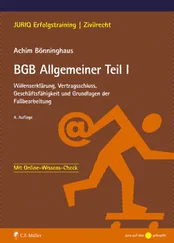Kann M vor Gericht eine Aufnahme in die IG Metall erzwingen?[15]
§ 3 Nr. 4 (jetzt § 3 Nr. 6) der Satzung der IG Metall lautete:
„Die Aufnahme in die IG Metall kann durch Beschluss des zuständigen Ortsvorstandes verweigert oder innerhalb von drei Monaten rückgängig gemacht werden, wenn dies im Interesse der IG Metall notwendig erscheint. Nicht aufgenommen werden dürfen: Personen, die durch ihr Verhalten Maßnahmen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterstützt haben, sowie Personen, die Mitglied einer gegnerischen Organisation sind, und Personen, die Vereinigungen angehören oder unterstützen, deren Handlungen und Aktionen gewerkschaftsfeindlich sind. Gegen die Entscheidung des Ortsvorstandes kann beim Vorstand Einspruch erhoben werden. Dieser entscheidet endgültig.“
Lösung:Wie jeder Verein, entscheidet auch eine Gewerkschaft grundsätzlich frei darüber, wen sie als Mitglied aufnehmen will.
Ein Aufnahmeanspruch kann sich allerdings aus der Satzung einer Gewerkschaft ergeben, wenn ein Antragsteller die dort genannten Voraussetzungen erfüllt. Die Satzung der IG Metall sieht keinen unbedingten Aufnahmeanspruch vor. Durch die Klausel, die Aufnahme könne verweigert werden, wenn dies im Interesse der IG Metall notwendig erscheine, hat sich die IG Metall einen so großen Ermessensspielraum vorbehalten, dass es nicht gerechtfertigt erscheint, Dritten einen Anspruch auf Aufnahme kraft Selbstverpflichtung der Gewerkschaft zuzuerkennen. M kann daher nicht unmittelbar auf Grundlage der Satzung die Aufnahme in die Gewerkschaft verlangen.
Ein Anspruch auf Aufnahme könnte sich aber aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen und mittelbar aus Art. 9 III 2 GG ergeben. Die Rechtsprechung hat bisher einen Aufnahmezwang für Monopolverbände angenommen.[16] Die IG Metall ist aber im strengen Sinne kein Monopolverband, da es auch noch andere, wenngleich winzige Industriegewerkschaften im Metallbereich gibt. Fraglich ist daher, ob dennoch ein Aufnahmezwang anzunehmen ist. Der innere Grund für den Aufnahmezwang entgegen der Selbstbestimmung des Vereins liegt nach dem BGH darin, dass der jeweilige Verein „im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich eine überragende Machtstellung innehat und ein wesentliches oder grundlegendes Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft besteht“.[17] Da die Mitgliedschaft in der IG Metall die Rechtsstellung eines Arbeitnehmers entscheidend verbessert (Streikgeld, Gewährung von Rechtsschutz und sozialen Leistungen), ist die IG Metall grundsätzlich einem Aufnahmezwang für eintrittswillige Bewerber ihres Wirkungskreises unterworfen.
Der Aufnahmezwang findet jedoch seine Grenzen mit Rücksicht auf das Interesse des Vereins in dessen Funktionsfähigkeit. Die Gewerkschaften sind deshalb nicht verpflichtet, Gewerkschaftsfeinde aufzunehmen. In casu ist daher die Frage entscheidend, ob M aufgrund seiner bisherigen Mitgliedschaft in der KPD als Gewerkschaftsfeind anzusehen ist. M ist aus der KPD ausgetreten und hat zudem bei ihrer Auflösung mitgewirkt. Der BGH ist der Ansicht, dass es nicht allein auf persönliche Erklärungen über die Abkehr von einer gewerkschaftsfeindlichen Linie ankommen könne. Vielmehr sei zusätzlich die Zeit zwischen der Beendigung der Mitgliedschaft und der Aufnahme in die Gewerkschaft ausschlaggebend. Diese Karenzzeit betrage durchschnittlich etwa drei Jahre. Könne die Gewerkschaft keine Tatsachen behaupten und beweisen, aus denen geschlossen werden könne, dass der Antragsteller seinen früheren Zielen noch anhänge, so müsse die Gewerkschaft den Antragsteller aufnehmen. Da die IG Metall insoweit nichts vorgetragen hat, muss sie M aufnehmen.
§ 1 Rechtsgeschäft und Willenserklärung› II. Rechtsgeschäft und Vertrauenshaftung
II. Rechtsgeschäft und Vertrauenshaftung
10
Rechtsverhältnisse werden in Selbstbestimmung durch Rechtsgeschäfte gestaltet. Daraus folgt die Bindung an die so abgegebenen rechtsgeschäftlichen Erklärungen und die Möglichkeit sich darauf zu berufen. Grund für die Rechtsgeltung der Gestaltung durch Willenserklärung ist aber nicht der Vertrauenstatbestand, der damit gesetzt wird, sondern das Selbstbestimmungsrecht, das vom Staat anerkannt wird.
1. Haftung für den Rechtsschein einer Willenserklärung
11
Der Vertrauensgesichtspunkt kommt ins Spiel, sobald die Selbstbestimmung fehlerhaft ist. Nicht jeder Fehler bei der Willensbildung soll den Einzelnen berechtigen, sich von seiner Erklärung wieder loszusagen. Es ist vielmehr Aufgabe der Rechtsordnung, Regeln dafür aufzustellen, auf welche Art und Weise man von dem Selbstbestimmungsrecht durch Vertragsschluss Gebrauch machen und wie man sich ggf. von seinen Erklärungen wieder lösen kann. Im Rahmen des Allgemeinen Teils hat die Vertrauens- bzw. Rechtsscheinhaftungvor allem in den Fällen eines Rechtsscheins der Vertretungsmacht Bedeutung[18] (s. Rn. 285 f).
2. Vertragshaftung ohne oder vor Vertragsschluss
12
Von der zweckgerichteten Gestaltung von Rechtsverhältnissen durch Rechtsgeschäft zu unterscheiden ist die Vertragshaftung ohne Vertrag.[19] An sich wäre es naheliegend, anzunehmen, dass ohne Vertrag auch keine vertraglichen Ansprüche bestehen. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt.
a) Faktische Vertragsverhältnisse
13
Im Bremer Straßenbahnfallbenutzte ein achtjähriger Junge die Straßenbahn zu einer Spazierfahrt, ohne zu bezahlen. Die Verkehrsvertriebe verlangten den Fahrpreis und das erhöhte Beförderungsentgelt.[20] Im Hamburger Parkplatzfallparkte ein Autofahrer auf einem parkgeldpflichtigen Parkplatz und erklärte dem Bewachungsunternehmer, er wünsche keine Bewachung und wolle auch nicht bezahlen. In diesem Fall einer protestatio facto contraria kam der BGH zu dem Ergebnis, dass dem Leistenden Erfüllungsansprüche zustünden, und zwar allein aufgrund der Inanspruchnahme der Leistungen (Lehre vom Vertragsschluss durch sozialtypisches Verhalten bzw. Lehre vom faktischen Vertrag).[21] Diese Lehre wird heute als überflüssig abgelehnt: Das Verhalten sei in der Regel als konkludente Willenserklärung(§§ 133, 157 BGB) auszulegen und dabei der Minderjährigenschutz stets zu beachten.[22] Es gilt demnach der Satz: Protestatio facto contraria non valet! Ein dem eigenen Verhalten zuwiderlaufender Vorbehalt ist unwirksam. Die Gegenposition betont die Privatautonomie, verneint daher einen Vertragsschluss und kommt zu einer bereicherungsrechtlichen Lösung (siehe Fall 31).
b) Rechtsverhältnis der Vertragsverhandlungen
14
Eine rechtsgeschäftliche Haftung entsteht nach §§ 280 I, 311 II, 241 II BGB nicht erst mit Vertragsschluss, sondern bereits aus Pflichtverletzungen im Rahmen von Vertragsverhandlungen (culpa in contrahendo) oder sonstigen geschäftlichen Kontakten.[23]
c) Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
15
Die Haftung nach Vertragsrecht kann nicht nur gegenüber dem Kontrahenten, sondern je nach Sachlage auch gegenüber Dritten, denen die Vertragsleistung (auch) zu erbringen ist bzw. an deren Schutz der Kontrahent ein besonderes Interesse hat („Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“) bestehen; ob § 311 III 1 BGB als sedes materiae angesehen werden kann, ist umstritten.[24]
16
Schließlich können sogar Dritte nach Vertragsgrundsätzen haften, wenn sie bei Vertragsverhandlungen mitgewirktund für sich selbst besonderes Vertrauenin Anspruch genommen haben (§ 311 III 2 BGB).[25]
§ 1 Rechtsgeschäft und Willenserklärung› III. Arten und Abgrenzung der Rechtsgeschäfte
Читать дальше