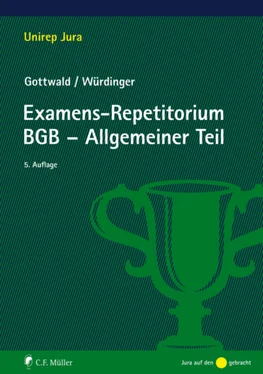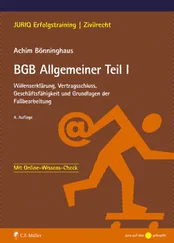III. Arten und Abgrenzung der Rechtsgeschäfte
1. Unterscheidung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft
17
Die Unterscheidung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft wird in der praktischen Anwendung sogar im Examen nicht selten übersehen. So ist insbesondere der Kauf unter Eigentumsvorbehalt (§§ 433, 449 BGB) von der bedingten Übereignung (§§ 929 S. 1, 158 I BGB), der Sicherungs vertrag von der Sicherungs übereignung zu unterscheiden. Eine häufige Fehlerquelle ist die Behandlung „der Schenkung“. Auch hier dürfen Verpflichtungsgeschäft (§§ 516 ff BGB) und Verfügungsgeschäft (z.B. §§ 929 ff BGB oder §§ 873 ff BGB) nicht vermengt werden. Bei einer Handschenkung fallen sie de facto zeitlich zusammen, sind aber de iure nach zutreffender Auffassung dennoch zu trennen.[26]
→ Definition:
Verpflichtungsgeschäfteschaffen einen oder mehrere Ansprüche. Zumeist beruhen sie auf einem schuldrechtlichen Vertrag. Zudem gibt es aber auch familien- oder erbrechtliche Verpflichtungsgeschäfte.
→ Definition:
Verfügungensollen dagegen ein subjektives Recht aufheben, übertragen, belasten oder inhaltlich neu ausgestalten. Verfügungen sind also Rechtsänderungen; dazu zählen z.B. die Übereignung von Sachen nach §§ 929 ff BGB bei beweglichen Sachen und nach §§ 873 ff BGB für unbewegliche Sachen, die Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB und die Übertragung sonstiger Rechte nach §§ 413, 398 BGB (auch wenn diese jeweils im Schuldrecht geregelt sind) sowie die Belastung oder Veränderung von Sachen.
Verfügender ist dabei nur derjenige, der Rechte überträgt, belastet, aufhebt oder inhaltlich verändert, nicht dagegen der Erwerber. Das gilt auch beim gutgläubigen Erwerb. Die Verfügung selbst schafft keinerlei Verpflichtungen.
18
Zur Wirksamkeit von Verfügungen bedarf es der Berechtigung des Verfügenden, nämlich seiner Verfügungsbefugnis(§ 185 I BGB). Verfügungsberechtigt ist grundsätzlich der Inhaber des Rechts oder der mit dessen Zustimmung Handelnde.[27] In bestimmten Fällen entzieht die Rechtsordnung dem Rechtsinhaber die Verfügungsberechtigung entweder vollständig, so z.B. im Fall der Insolvenz gemäß § 80 I InsO, oder teilweise, so z.B. im Fall der Zugewinngemeinschaft gemäß §§ 1365, 1369 BGB. Verfügungen eines Nichtberechtigten sind in der Regel unwirksam, sofern nicht die Regeln über den gutgläubigen Erwerb (§§ 892 f, 932 ff, 1207 BGB) eingreifen.
19
Während in der Regel nur der Berechtigte verfügen kann, kann sich jeder verpflichten, und zwar unabhängig davon, ob er tatsächlich imstande ist, den Vertrag zu erfüllen. Man kann also z.B. das Auto seines Nachbarn verkaufen. Selbst wenn die Leistung von Anfang an unmöglich ist, bleibt der Vertrag gemäß § 311a I BGB wirksam; eine etwaige Schadensersatzpflicht ergibt sich dann aus § 311a II BGB.
20
Fall 3:
Die Eheleute V leben im gesetzlichen Güterstand. Während eines Auslandsaufenthalts ihres Mannes veräußert Frau V ein ihr gehörendes Gemälde, das in der ehelichen Wohnung hängt, an K. Ist die Veräußerung wirksam, und kann Herr V von K Rückgabe verlangen?
Lösung:Herr V könnte die Herausgabe des Gemäldes von K nach §§ 985, 986 BGB verlangen, wenn seine Frau noch Eigentümerin des Gemäldes und K unberechtigter Besitzer wäre und wenn er das fremde Recht seiner Frau geltend machen dürfte.
Frau V war ursprünglich Alleineigentümerin des Bildes. Durch den gesetzlichen Güterstand entsteht kein gemeinschaftliches Vermögen, § 1363 II 1 BGB. Frau V war daher grundsätzlich auch verfügungsbefugt. Allerdings greift bei Verfügungen über Haushaltsgegenstände, die im Alleineigentum stehen, das absolute Veräußerungsverbot des § 1369 I BGB ein. Danach kann ein Ehegatte über ihm gehörende Gegenstände des ehelichen Haushalts nur mit Zustimmung des anderen wirksam verfügen. Ein guter Glaube hinsichtlich des Familien- und Güterstandes wird nicht geschützt. Die Verfügung der Frau V, die ohne Zustimmung ihres Ehemannes erfolgte, ist daher absolut unwirksam. Eigentümerin des Bildes ist folglich immer noch Frau V.
K ist Besitzer des Bildes (§ 854 I BGB). Ein Recht zum Besitz i.S.v. § 986 I 1 Var. 1 BGB könnte sich aus dem mit Frau V geschlossenen Kaufvertrag ergeben. Allerdings greift bei Verpflichtungsgeschäften über Haushaltsgegenstände wiederum § 1369 I BGB ein, sodass zusätzlich der Kaufvertrag (§ 433 BGB) unwirksam ist.
Frau V hat somit einen Herausgabeanspruch aus § 985 BGB. Diesen kann ihr Ehemann V nach §§ 1369 III, 1368 BGB als gesetzlicher Prozessstandschafter im eigenen Namen gegenüber K geltend machen (eigenes Klagerecht; sog. revokatorische Klage).[28] Er muss dabei primär Herausgabe an seine Frau verlangen.
21
Nur im Ausnahmefall wird der gute Glaube an die Verfügungsbefugnis geschützt.
22
Fall 4:
E beauftragt den Gebrauchtwagenhändler B, seinen gebrauchten Mercedes nicht unter 15.000 € zu veräußern und übergibt ihm die Zulassungsbescheinigung Teil II. B veräußert den Wagen alsbald für 10.000 € an K. Kann E von K Herausgabe verlangen?[29]
Lösung:E könnte einen Anspruch gegen K auf Herausgabe des Mercedes aus §§ 985, 986 BGB haben. Dazu müsste E noch Eigentümer sein.
I.E könnte sein Eigentum an dem Mercedes durch Übereignung des B an K gemäß § 929 S. 1 BGB verloren haben. Dazu müsste B aber, da er ja nicht selbst Eigentümer war, verfügungsbefugt i.S.d. § 185 I BGB gewesen sein. E erteilte die Verfügungsermächtigung nur begrenzt, d.h. im Rahmen eines bestimmten Kaufpreises und daher bedingt. Da B das Auto nicht zu diesem Kaufpreis veräußerte, hatte er keine Verfügungsbefugnis. Demnach wäre K nicht Eigentümer geworden. Fraglich ist, ob K den Gebrauchtwagen gutgläubig nach §§ 929 S. 1, 932 I 1 BGB erworben hat. § 932 BGB schützt nicht den guten Glauben an die Verfügungsbefugnis. Hinsichtlich einer Eigentümerstellung des B könnte K nicht in gutem Glauben (§ 932 II BGB) gewesen sein. B hat zwar die Zulassungsbescheinigung Teil II dieses Gebrauchtwagens vorgelegt, ist darin aber nicht ausgewiesen, sodass ohne entsprechende Nachforschungen jedenfalls von grober Fahrlässigkeit des K auszugehen ist. Ein gutgläubiger Erwerb nach §§ 929 S. 1, 932 I 1 BGB scheidet daher aus.
II.Der Mangel der fehlenden Verfügungsbefugnis des B könnte jedoch durch § 366 I HGB überwunden worden sein. Danach darf der Käufer in der Regel auf die Verfügungsbefugnis eines Kaufmanns vertrauen. Sein guter Glaube wird dabei vermutet.[30] Ohne besondere Verdachtsmomente braucht ein Privatkunde nicht zu überprüfen, auf welche Weise ein Händler in den Besitz von Wagen und Papieren gelangt ist und ob er sich an den erteilten Verkaufsauftrag hält. K wurde daher nach §§ 929 S. 1, 932 I 1 BGB, 366 I HGB Eigentümer.
III.Ein Herausgabeanspruch gemäß § 985 BGB besteht folglich nicht.
23
§ 366 HGB schützt nur den guten Glauben an die Verfügungsbefugnis, nach h.M. aber nicht den guten Glauben an eine nicht bestehende Vertretungsmacht.[31] Hätte der Händler den Mercedes daher im Namen des E veräußert, so wären Kauf wie Übereignung nach § 177 I BGB zunächst schwebend unwirksam.
Probleme mit der Verfügungsbefugnis ergeben sich besonders häufig im Kreditsicherungsrecht, z.B. bei Kollisionen von Vorausabtretungen künftiger Forderungen (verlängerter Eigentumsvorbehalt – Globalzession).
24
Für Verfügungen gilt das Spezialitätsprinzip. Spätestens beim Wirksamwerden von Verfügungen muss feststehen, auf welche konkreten Gegenstände sie sich beziehen. Zu beachten ist der Bestimmtheitsgrundsatz. Dieser hat große praktische Bedeutung bei der Sicherungsübereignung von Sachgesamtheiten wie etwa Warenlagern. Von einer Bestimmtheit ist dann auszugehen, wenn es infolge der Wahl einfacher, äußerer Abgrenzungskriterien für jeden, der die Parteiabreden in dem für den Eigentumsübergang vereinbarten Zeitpunkt kennt, ohne Weiteres ersichtlich ist, welche individuell bestimmten Sachen übereignet worden sind.[32] Dagegen kann beim Verpflichtungsgeschäft offen gelassen werden, mit welchen konkreten Gegenständen es erfüllt werden soll. Hier ist ein Gattungskauf möglich und die Verpflichtung ist wirksam, bevor sie sich konkretisiert.
Читать дальше