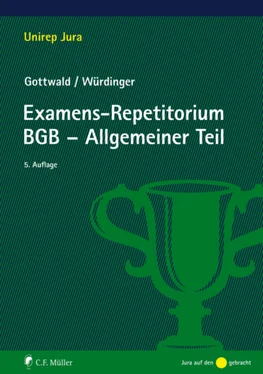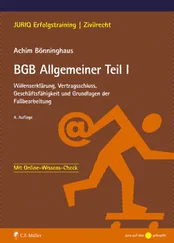Bei der Ausübung der Eigentumsrechte und damit des Hausrechts dürfen gemäß § 903 S. 1 BGB jedoch „nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen“. Daher muss eine Abwägung zwischen den Rechten des H und denen des G stattfinden, wobei sich die Frage stellt, ob auch Grundrechte einzubeziehen sind. Bei diesen handelt es sich in erster Linie um subjektive Abwehrrechte, die dem Einzelnen gegenüber dem Staat zustehen. Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht (Art. 1 III GG). Ihnen kommt darüber hinaus aber auch eine objektive Dimension zu. Sie entfalten eine Ausstrahlungswirkung auf privatrechtliche Rechtsbeziehungen und sind (insbesondere über zivilrechtliche Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe als deren Einbruchstelle) bei der Auslegung des Fachrechts zur Geltung zu bringen (mittelbare Drittwirkung der Grundrechte).[10] Im Rahmen einer Interessenabwägung stehen also die Eigentumsgarantie (Art. 14 I GG), die unternehmerische Freiheit (Art. 12 I GG) und die Privatautonomie (Art. 2 I GG) – gebündelt im Hausrecht des H – dem Persönlichkeitsrecht (Art. 2 I iVm Art. 1 I GG) des G sowie dem Diskriminierungsverbot (Art. 3 III 1 GG) gegenüber.[11] Für das Ergebnis der Interessenabwägung ist weiterhin maßgeblich, welcher Zeitraum betroffen ist.
II.Im Grundsatz bedarf die Entscheidung, ob jemandem Zugang zu einer Örtlichkeit gewährt wird, keiner Rechtfertigung. Allerdings könnte der Fall hier anders liegen: H hat das Hotel für den allgemeinen Publikumsverkehr geöffnet und dadurch möglicherweise zu verstehen gegeben, dass für ihn die konkrete Person des Gastes in den Hintergrund tritt. Dadurch könnte er nach außen erkennbar gemacht haben, dass er auf eine Einzelprüfung verzichtet. Dies schließt zwar nicht per se aus, den Aufenthalt an Bedingungen zu knüpfen. Ohne solche Bedingungen bzw. bei deren Erfüllung muss dann aber ein sachlicher Grundvorliegen, um einer bestimmten Person den Zugang zu verwehren. Fehlt es an einem solchen sachlichen Grund, ist das Hausverbot rechtswidrig. So wurde z.B. in einem ähnlichen Fall eines bundesweiten Stadionverbots entschieden.[12] Allerdings muss hier beachtet werden, dass es sich bei den Örtlichkeiten des H um ein Wellnesshotel handelt. Bei einem solchen ist nach außen erkennbar, dass nur ein bestimmter, eingeschränkter Personenkreis Zutritt erhalten soll, damit eine dem Etablissement entsprechende Atmosphäre geschaffen und aufrechterhalten werden kann. Insofern ist ein Wellnesshotel gerade nicht für den allgemeinen Publikumsverkehr geöffnet. Im Rahmen der Abwägung ist außerdem zu berücksichtigen, dass G nur in seiner privaten Freizeitgestaltung betroffen ist, wohingegen H einer unternehmerischen Verantwortung ausgesetzt ist. Damit bedarf es jedenfalls für den Zeitraum, der nicht von der Buchung des G betroffen ist, keines sachlichen Grundes, um G den Zutritt zu verweigern.
Aus der speziellen zivilrechtlichen Regelung der § 19 I Nr. 1 iVm § 21 I 1 AGGergibt sich keine Einschränkung: Zum einen erscheint bereits fraglich, ob der Aufenthalt in einem Wellnesshotel überhaupt unter den Tatbestand fällt. Zum anderen hat der Gesetzgeber bewusst Abstand davon genommen, auch Benachteiligungen aufgrund politischer Überzeugungen unter das Diskriminierungsverbot des AGG zu fassen.[13]
III.1. Etwas anderes könnte jedoch für den Buchungszeitraum gelten. Hier bestand nämlich zwischen G und H eine vertragliche Bindung. H hat sich verpflichtet, G Zutritt zu dem Hotel zu gewähren. Als Ausfluss der Privatautonomie gilt der Grundsatz, dass Verträge einzuhalten sind (pacta sunt servanda) .
2. Möglicherweise konnte sich H aber von dem Vertrag lösen. Die Erteilung des Hausverbots lässt sich als Anfechtungserklärung (§ 143 I BGB) bzw. als Kündigungserklärung auslegen (§§ 133, 157 BGB). Bei einer wirksamen Anfechtung wäre der Vertrag gemäß § 142 I BGB ex tunc nichtig. Eine Kündigung ist hingegen zukunftsgerichtet und wirkt ex nunc.
a) In Betracht kommt eine Anfechtung wegen eines Eigenschaftsirrtums gemäß § 119 II BGB. Allerdings hat sich H zum maßgeblichen Zeitpunkt des Vertragsschlusses um die Gesinnung des G keine Gedanken gemacht und unterlag insofern keinem Irrtum. Zudem waren H die Gründe, welche die Anfechtung tragen sollten, bereits am 19.11. bekannt. Die Erklärung am 8.12. erfolgte daher jedenfalls nicht mehr ohne schuldhaftes Zögern und damit nicht mehr unverzüglich i.S.d. § 121 I 1 BGB.
b) Eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung (§ 123 I Alt. 1 BGB)durch Unterlassen wäre denkbar, wenn G seine politische Gesinnung und Parteifunktion hätte offenlegen müssen. Gegen eine derartige Aufklärungspflicht streitet, dass verschiedene politische Überzeugungen einer demokratischen Grundordnung wesensimmanent sind. Im Alltag ist stets mit dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher politischer Meinungen zu rechnen. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass die bloße Anwesenheit des G im Hotel des H den Aufenthalt der anderen Hotelgäste hätte beeinträchtigen können. G verweilte bereits in der Vergangenheit in diesem Hotel, ohne dass es zu Komplikationen kam. Jedenfalls bei einem privaten Wellnessbesuch, der keinen Bezug zur politischen Gesinnung und Parteifunktion des G aufweist, ist eine Offenbarungspflicht abzulehnen.
c) Fraglich ist, ob H den Vertrag wirksam kündigen konnte. Bei einem Hotelbeherbergungsvertrag handelt es sich um einen typengemischten Vertrag mit dienst-, werk-, miet- und kaufvertraglichen Elementen, wobei der Mietvertragscharakter überwiegt. Eine dementsprechende Kündigung nach § 543 I 1 BGBsetzt einen wichtigen Grund voraus. G musste seine Parteifunktion nicht offenlegen. Eine Pflichtverletzung des G bestand daher nicht. Mangels zu erwartender Beeinträchtigungen für die Gäste ist H die Vertragsdurchführung zumutbar, sodass die Kündigungsvoraussetzung nicht erfüllt ist.
d) Damit konnte H die vertragliche Bindung weder durch Anfechtung noch durch Kündigung beseitigen. Das Hausverbot war also für den Buchungszeitraum rechtswidrig.
IV.H ist an den mit G geschlossenen Vertrag gebunden (pacta sunt servanda) . G hat gegen H daher für den Buchungszeitraum einen Anspruch auf „Widerruf“ des Hausverbots. H ist aber aufgrund der Privatautonomie nicht verpflichtet, G künftig in sein Hotel aufzunehmen.
2. Vereinigungsfreiheit und Aufnahmezwang
8
Im Vereinsrecht ist die Parallele zur Abschlussfreiheit die Vereinigungsfreiheit (Art. 9 I GG). Die Entscheidung über die Annahme eines Aufnahmeantrags steht deshalb regelmäßig im Belieben des Vereins, d.h. – je nach Satzung – seines Vorstandes, eines Aufnahmeausschusses oder der Mitgliederversammlung. Ein Aufnahmezwang kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn der Verein eine Monopolstellung hat, etwa bei Berufsvertretungen, oder wenn die Mitgliedschaft Voraussetzung für öffentliche Zuschüsse ist, wie bei manchen Jugend- und Sportverbänden.[14] Im Kartellrecht gibt es einen Aufnahmezwang nach § 20 V GWB. Danach können Wirtschafts- und Berufsvereinigungen sowie Gütezeichengemeinschaften zur Aufnahme eines Unternehmens verpflichtet sein.
9
Fall 2:
Der Maschinenschlosser M, der bei dem Unternehmen G beschäftigt ist, beantragte im März 1985 die Mitgliedschaft bei der IG Metall. Deren zuständige Verwaltungsstelle lehnte den Aufnahmeantrag im Mai 1985 mit der Begründung ab, M sei von 1976 bis 1980 Mitglied der von ihm selbst als maoistisch bezeichneten KPD gewesen. Diese habe gewerkschaftsfeindliche Ziele verfolgt. M habe noch heute eine gewerkschaftsfeindliche Einstellung. M entgegnet, er habe im März 1980 selbst an der Auflösung der KPD mitgewirkt, da deren politische Auffassung und Grundsätze gescheitert seien. Die gewerkschaftsfeindlichen Ziele der ehemaligen KPD verfolge er nicht weiter.
Читать дальше