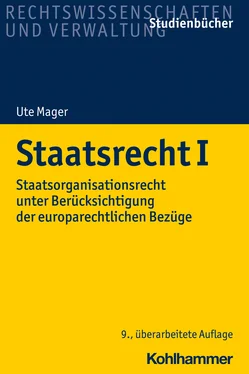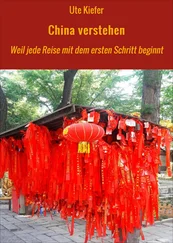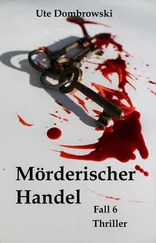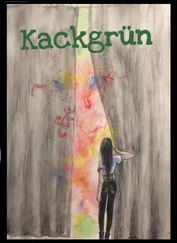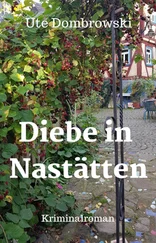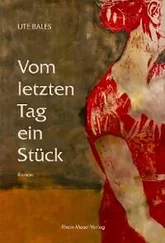3. Prüfung der materiellen Rechtswidrigkeit.Während der Bundestag im Rahmen des Wahlprüfungsverfahrens auf die Überprüfung der rechtmäßigen Anwendung des geltenden Rechts beschränkt ist, ist es Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, nicht nur die Rechtmäßigkeit der Rechtsanwendung zu prüfen, sondern auch die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Vorschriften, die der Wahl zugrunde liegen. W rügt keine Fehler bei der Anwendung des EuWahlG, sondern den Verstoß der 3 %-Sperrklausel des EuWahlG gegen die Verfassung. Dies liegt im Rahmen der verfassungsgerichtlichen Prüfungskompetenz.
a) Prüfungsmaßstab
aa) Unionsrechtlicher Rahmen.Außerhalb des verfassungsgerichtlichen Prüfprogramms liegen die verbindlichen unionsrechtlichen Vorgaben für die Wahl zum Europäischen Parlament. Art. 8 Abs. 1 des unionsrechtlichen Direktwahlaktes bestimmt, dass sich das Wahlverfahren in den Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Regelungen des Direktwahlaktes nach den innerstaatlichen Vorschriften bestimmt. Nach Art. 1 Abs. 1 des Direktwahlaktes ist die Wahl zum Europäischen Parlament als Verhältniswahl durchzuführen. Art. 3 des neuen Direktwahlaktes bestimmt, dass Mitgliedstaaten, die über mehr als 35 Sitze im Europäischen Parlament verfügen, für die Sitzvergabe eine Sperrklausel von mindestens 2 % festlegen müssen und eine Sperrklausel bis zu maximal 5 % einfügen können. Mit dieser Regelung ist die Einführung einer Sperrklausel von 2 % verbindlich vorgegeben und bis zu 5 % erlaubt. Daraus folgt, dass die 3 %-Sperrklausel nach dem EuWahlG auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz überprüft werden kann und muss.
bb) Wahlrechtsgleichheit.Die Wahlrechtsgrundsätze gemäß Art. 38 Abs. 1 GG sind nach ihrem ausdrücklichen Wortlaut nur auf die Wahlen zum Bundestag anwendbar. Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl folgt für die Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament jedoch aus der Gleichheit aller Wahlberechtigten gemäß Art. 3 Abs. 1 GG. Aus dem Demokratieprinzip folgt, dass die Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger bei der Stimmabgabe eine streng formale Gleichheit ist. Im Rahmen eines Verhältniswahlsystems bedeutet dies, dass jede Stimme den gleichen Zählwert und grundsätzlich auch den gleichen Erfolgswert haben muss. Entsprechende Gleichheitsanforderungen folgen auch aus dem Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG.
b) Verletzung
aa) Beeinträchtigung der Erfolgswertgleichheit.Die 3 %-Sperrklausel bewirkt, dass die Wählerstimmen für Parteilisten, die im Ergebnis nicht mindestens 3 % aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnten, ohne Auswirkung auf die Sitzverteilung bleiben. Sie sind zwar zunächst mit gleichem Gewicht wie alle anderen Stimmen gezählt worden, ihr Erfolgswert liegt aber bei null. Darin liegt im Rahmen eines Verhältniswahlsystems eine Ungleichbehandlung.
bb) Rechtfertigung
(1) Maßstab.Trotz der strikten Anforderungen der Wahlrechtsgleichheit in Verbindung mit der Chancengleichheit der Parteien ist nicht jegliche Differenzierung ausgeschlossen. Erlaubt sind solche Ausnahmen, die im Blick auf das Ziel der Wahl, ein funktionsfähiges Parlament zu schaffen, unabdingbar sind. An diese Prüfung ist ein strenger und konkret auf die Funktionen des jeweiligen Parlaments bezogener Maßstab anzulegen, der sich an der politischen Wirklichkeit zu orientieren hat und ggf. veränderten Umständen anzupassen ist. Verfolgt eine Regelung ein unzulässiges Ziel oder ist sie zur Verfolgung eines zulässigen Ziels ungeeignet oder nicht erforderlich, so ist sie verfassungswidrig. Mit einer Sperrklausel wird das legitime Ziel verfolgt, eine Zersplitterung des Parlaments zu vermeiden und zur Sicherung der Meinungs- und Mehrheitsbildung im Parlament beizutragen. Eine Sperrklausel ist zur Verfolgung dieses Zwecks grundsätzlich geeignet. Einer genauen und die jeweiligen tatsächlichen Umstände konkret berücksichtigenden Prüfung bedarf jedoch die Erforderlichkeit der Höhe der Sperrklausel im Blick auf das verfolgte Ziel. Es genügt nicht die pauschale Behauptung, die Funktionsfähigkeit des Parlaments werde verbessert. Die Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit muss vielmehr mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein. Allerdings ist dem Gesetzgeber insoweit auch ein Einschätzungsspielraum zuzugestehen.
(2) Subsumtion.Nach den Angaben im Sachverhalt ist auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen bei Senkung der 3 %-Klausel auf 2 % nur mit einer Erhöhung der Zahl der erfolgreichen Parteien um 2 weitere Parteien zu rechnen. Auch sind im Europäischen Parlament ohnehin bereits mehr als 200 Parteien vertreten, darunter insbesondere aus den kleineren Mitgliedstaaten eine große Anzahl mit nur sehr wenigen Abgeordneten. Diese Vielzahl von Parteien wird zur Zeit in acht Fraktionen gebündelt, von denen die beiden größten nach wie vor die absolute Mehrheit erreichen. Es gehört zudem nicht zu den Aufgaben des Europäischen Parlaments, eine Regierung dauerhaft zu stützen. Die Ausübung der Kontrollfunktion des Parlaments bedarf ohnehin keiner Mehrheitsbildung, sondern ist als Minderheitsrecht ausgestaltet. Die mögliche Beeinträchtigung gerade deutscher Interessen durch Zersplitterung des deutschen Sitzkontingents im Europäischen Parlament stellt zwar ein gewichtiges politisches Interesse dar, ist jedoch verfassungsrechtlich ohne Bedeutung.
Auf der anderen Seite kommen dem Europäischen Parlament in fast allen Regelungsbereichen des Unionsrechts Mitwirkungsbefugnisse im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zu. Es ist nicht garantiert, dass die beiden größten Fraktionen sich stets einigen, so dass es gerade bei besonders wichtigen Gesetzesvorhaben zu Blockaden kommen kann. Auch ist nicht auszuschließen, dass eine Absenkung der Sperrklausel auf 2 % angesichts der zunehmenden Zersplitterung der Parteienlandschaft dazu führt, dass eine deutlich größere Anzahl die 2 %-Hürde überspringt. An die konkrete Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments sind insoweit geringere Anforderungen zu stellen, als sich das Europäische Parlament aus den Abgeordneten aller Mitgliedstaaten zusammensetzt, und damit die Ausgestaltung des Wahlrechts in Deutschland von vornherein nur sehr vermittelt Auswirkungen auf dessen Funktionsfähigkeit haben kann. Insoweit muss es genügen, dass das Europäische Parlament selbst Gefahren für seine Funktionsfähigkeit sieht und für die Bekämpfung den Mitgliedstaaten einen Spielraum gewährt. Mit der moderaten Erhöhung der Mindestsperrklausel von 2 % auf 3 % hat der Bundesgesetzgeber seinen Einschätzungsspielraum nicht überschritten.
3. Ergebnis.Es liegt kein Verstoß gegen die Wahlrechtsgleichheit der Bürgerinnen und Bürger und die Chancengleichheit der Parteien vor. 125
4. Ergebnis.Die Einführung der 3 %-Sperrklausel ist verfassungsgemäß.
III. Ergebnis
Die Wahlprüfungsbeschwerde der W ist zulässig, aber unbegründet.
Fall 3:Spitzenkandidaten
Das ZDF plant vor der anstehenden Bundestagswahl eine Sendung mit dem Titel „Zuschauer fragen Spitzenkandidaten“. In dieser Sendung sollen sich die Spitzenkandidaten der drei größten im Bundestag vertretenen Parteien den telefonischen Fragen von Zuschauern stellen sowie unter der Leitung eines Moderators von drei in der Sendung anwesenden Journalisten befragt werden. Die Sendung soll drei Tage vor der Wahl stattfinden und einen Höhepunkt unter den redaktionell gestalteten Sendungen im Vorfeld der Wahl bilden.
Die Spitzenkandidaten der drei kleineren im Bundestag vertretenen Parteien verlangen, dass auch sie in der Sendung auftreten dürfen. Das ZDF wendet ein, dass die Sendezeit nicht für substanzielle Befragungen von sechs Spitzenkandidaten ausreiche.
Читать дальше