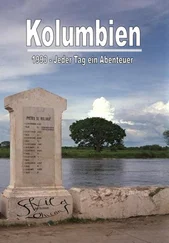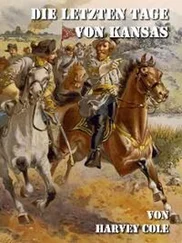© 2021 – e-book-Ausgabe
Rhein-Mosel-Verlag
Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel
Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158
www.rhein-mosel-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-89801-909-5
Ausstattung: Stefanie Thur
Titelbild: »Auflösung« von Melanie Ziemons-Mörsch
Lektorat: Michael Dillinger
Korrektorat: Melanie Oster-Daum
Autorenfoto: Michael Spiegelhalter
Vom letzten Tag ein Stück
Roman
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Das Land, wo meine Rosen blühn, wo meine Freunde wandelnd gehn, wo meine Toten auferstehn, das Land, das meine Sprache spricht – oh Land, wo bist du?
Franz Schubert, aus: »Der Wanderer«
1.
Wenn ich die Augen schließe, ist alles wieder da: unser Berg, der Ginster, die Schlehenhecken, der Hühnervogel, der anderswo Mäusebussard heißt.
Auch Bertram ist wieder da. Er läuft mir entgegen, über die Felder, mit wehenden Haaren und geröteten Wangen. Er lacht und winkt. Ich will ihm folgen, da sehe ich das halbe Dorf herannahen, höre das Getrappel ungezählter Schuhe auf der Straße nach Norden, immer nach Norden.
Bepackt mit Koffern und Taschen eilen Männer und Frauen, Alte und Kinder in Richtung des Berges. Ein Auto überholt mich, wirbelt Staub auf, fegt mich zur Seite. »Weiter, weiter!«, schreit jemand, stößt mich mit seinem Koffer in die Rippen und, bemüht, Bertrams tanzende Mütze im Blick zu behalten, lasse ich mich mitreißen, laufe den anderen hinterher, denn die anderen, die werden schon wissen, wo es hingeht. Sie stoßen und schieben mich; ich werde Teil dieser Menge, die sich lockert und wieder dichter wird, keuchend und kommandierend, wogende Köpfe und Schultern, ein Wirbel von Beinen, stampfend und fordernd, unterwegs entlang der schmutzigen Ackerränder, hinauf auf den Gipfel.
Oben auf dem Kamm stehen wir dicht an dicht, außer Atem, und starren, die Hände über den Augen, in den Himmel, der sich zuzieht. Der Horizont glimmt rot und drohend hinter einer Wand aus Wolken. Die Wolken sind fast schwarz und lassen hier und da weißes Licht durch, das anders ist als Nebel, feiner und wärmer. Jetzt erst fällt mir auf, dass auch die Tiere da sind. Hühner und Schweine, Kühe, auch Truthähne. Die Tiere sind unruhig. Es wird bald regnen, ich kann es spüren, die Luft hat sich verändert.
Bertram steht neben mir mit seinem Feldstecher und hat schon ein ganz schiefes Gesicht vom Schauen durch das Rohr. Ich frage ihn, was er sieht, aber er reguliert nur hektisch die drehbaren Linsen seines Glases und richtet den Blick weiterhin nach oben. Ich entdecke meine Tante und winke ihr. Sie trägt ein Tuch aus Spinnweben um den Kopf und kramt in ihrer Tasche. Dann schwenkt sie eine Tafel Schokolade und ruft: »Fang auf! Fang doch!«, aber ich kann nicht zu ihr, zu viele Leute sind es und die Tante ruft und lacht und schwenkt die Schokolade und ihre weißen Zähne blitzen.
»Am Jüngsten Tag treffen wir uns oben auf dem Berg«, sagte mein Vater und seine Worte machten Mut. »Niemand braucht Angst zu haben, wenn die Erde bebt, der Himmel bricht, die Gräber umgedreht, die Seen ausgegossen werden und die anderen Berge wie Wollbüschel davonfliegen. Wir werden alle zusammenstehen. Dicht beieinander. Auch die Tiere werden dort sein. Pferde und Kühe, sogar die Hühner. Oben auf dem Kamm werden wir stehen und uns bereithalten für den allerletzten Tag. Und für die Nacht ohne Morgen.« Das sagte mein Vater und ich konnte nicht aufhören, mir vorzustellen, was dann kommen würde.
2.
Die Zeit ist schneller als ich. Sie hat mich längst überholt, hat alle überholt, sogar Bertram, von dem ich immer dachte, dass er nie einzuholen sei. »Vielleicht sind wir die Letzten«, höre ich ihn sagen, und ich weiß, was er meint.
Bertram sagt, es gibt zwei Sorten von Leuten in unserem Dorf. Diejenigen, die meinen, dass alles in der Welt besser, größer und bedeutender ist als das, was wir haben. Und diejenigen, die allem, was wir haben, eine besondere Bedeutung zuschreiben, die Dinge sozusagen erhöhen, indem sie sagen: Hör zu, bei uns daheim, da blüht jetzt der Ginster und Vulkane haben wir auch, und Quellen, deren Wasser rund um den Globus verschifft wird, und die Wiesen sind grün und die Kinder grüßen einen noch, wenn man die Straße entlang geht und aus jedem Haus geht einer mit, wenn einer gestorben ist und segnet mit einem Palmstrauß das Grab, im Namen des Vaters. Anders als in der Stadt, wo sich die Leute nicht kennen und es vorkommen kann, dass Tote tagelang in der Wohnung liegen, so lange, bis sie stinken und in erbärmlicher Einsamkeit auf einem Rasenstück verscharrt werden.
Bertram gehört zur zweiten Sorte. Er meint, dass es eine Bedeutung hat, wann und wo ein Mensch geboren ist und dass er genau dort auch hingehört. Wie ein Baum.
Ich hingegen hätte gerne woanders gelebt. In einer großen Stadt mit weitläufigen Parks, breiten Straßen und Häusern mit Aufzügen, mit einer Oper und Theatern, Kaufhäusern mit mehreren Galerien und Cafés, in die Dichter und Musiker einkehren.
Für Bertram sind die Städte keine Option. Es gibt keinen Platz dort, meint er, nicht für einen wie ihn. Es sei alles dicht an dicht, Häuser und Autos und Menschen, eine wabernde Masse, anonym und ohne Konturen. Er hasst die gleichförmigen Kulissen der Wohnblocks, die verschachtelten Hochhäuser, echauffiert sich über hässliche und menschenüberfüllte Betonklötze, über monotone Straßen und unterirdische, nach Urin stinkende Passagen, über abgezirkelte Gärten und Parkanlagen mit künstlich angelegten Beeten. »Was denken sich die, die so was bauen? Wie soll ein Mensch in so einem Siedlungsbrei leben, geschweige denn sich dort mit irgendwas verbunden fühlen?« Sogar über Blumenkästen auf von Auspuffgasen schwarz gewordenen Balkonen regt er sich auf. Nie hätte er in einer Stadt leben können.
Früher hat Bertram auf dem Hof mitgeholfen, aber seit dem Tod der Eltern sieht er darin keinen Sinn mehr. Er hat das Vieh verkauft, aber die Felder behalten, obwohl er sie nicht nutzt. Im Dorf sagen alle, dass es mit der Landwirtschaft vorbei ist und er getrost verkaufen kann. Aber Bertram behält seine Felder. Wer weiß, was noch kommt. Er meint, dass, solange er sie behält, die Felder dann wenigstens Felder bleiben dürfen.
Bertram wohnt unterhalb unseres Berges, im letzten Haus des Dorfes. Oder im ersten. Wie man es sieht. Jedenfalls abseits. Das Grundstück umfasst mehrere Morgen. Vor dem Haus verteilen sich auf einer Wiese Obstbäume, die von einem morschen Zaun umgeben sind. Im Herbst biegen sich die Äste unter der Last der Früchte. Das Obst wächst verschwenderisch. Eimerweise Äpfel. Saftige, süßsaure Früchte.
Im Garten hinter dem Haus hat Bertrams Vater vor Jahren Kartoffeln, Rüben, Bohnen und Erbsen gezogen, aber auch Spalierobst wuchs dort und Goldruten, die mit ihrem Gelb den Nachsommer schmückten. Das Schönste war ein Mirabellenbaum, den es leider nicht mehr gibt. Er gehörte zu meiner Vorstellung vom Paradies. Im August hingen süße, runde, rotgesprenkelte Früchte an seinen Zweigen. Dann brummte der Baum vor Bienen und Wespen, und ich durfte mir die Taschen füllen, so oft ich wollte.
Bertrams Haus ist geräumig mit vielen Zimmern. Die Räume haben niedrige Decken und sind vollgestopft mit Dingen, die mehrere Generationen angesammelt haben und von denen sich Bertram nicht trennen kann. In Stall und Scheune rosten alte Gerätschaften. Im Schuppen mit dem Wellblechdach stehen ein alter Pflug und ein Schubkarren mit platten Reifen, dazu ein Trecker, der entsetzlich stinkt, wenn man ihn startet. Holzbretter lehnen an der Wand und breite Rollen Maschendrahtzaun. Winterreifen liegen aufgetürmt. Straßenbesen warten mit abgeschrubbten Borsten. Auf der Fensterbank verstauben Mittel gegen Kartoffelfäule.
Читать дальше