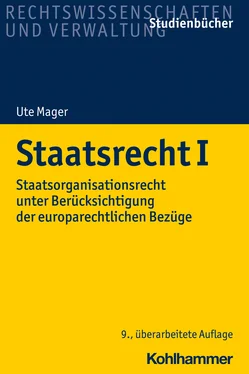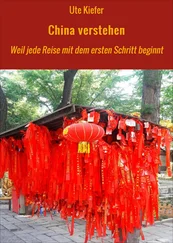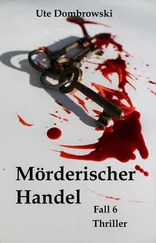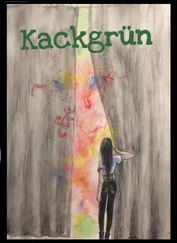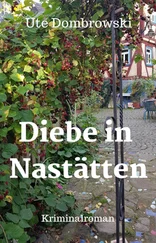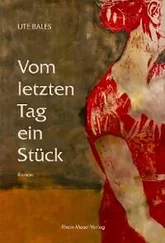Der Bundestag überprüft allein die Gesetzmäßigkeit einer Wahl, dagegen nicht die Verfassungsmäßigkeit des einfachen Wahlrechts am Maßstab der verfassungsrechtlichen Wahlrechtsgrundsätze, etwa die Bestimmungen über die Wahlkreiseinteilung oder die Regelungen über die Überhangmandate. Dies bleibt dem Bundesverfassungsgericht im Verfahren der Wahlprüfungsbeschwerde vorbehalten. 117
127Nicht jeder Wahlfehler führt zu einer über die Feststellung der Rechtswidrigkeit hinausgehenden Rechtsfolge. Zweck des Wahlverfahrens ist es, die ordnungsgemäße Zusammensetzung des Parlaments zu gewährleisten. Da Gegenstand der Wahlprüfung die Frage der Gültigkeit der Wahl ist, hat ein Einspruch nur Erfolg, wenn ein Wahlfehler sich auf die Gültigkeit der Wahl zumindest eines Abgeordneten ausgewirkt, dh. Mandatsrelevanzentfaltet haben kann. Das Bundesverfassungsgericht formuliert, dass ein Wahlfehler für das Wahlprüfungsverfahren unbeachtlich ist, wenn sich aus ihm angesichts der Stimmenverhältnisse eine Änderung der Mandatsverteilung nicht ergeben kann. 118Schon aus diesem Grund sind Wahlprüfungsbeschwerden in der Regel „erfolglos“. Im Rahmen der Wahlprüfungsbeschwerde zum Effekt des negativen Stimmengewichts hat das Bundesverfassungsgericht trotz Wahlfehlers und Mandatsrelevanz die Wahl bestehen lassen. Da die Mandatsrelevanz keinem einzelnen Abgeordneten zugeordnet werden konnte, wäre eine Korrektur allein durch Auflösung und Neuwahlen möglich gewesen. Es ist nachvollziehbar, dass diese Maßnahme dem Gericht völlig außer Verhältnis zu den Auswirkungen des Wahlfehlers schien. 119Sofern das Bundesverfassungsgericht die Wahl nicht für ungültig erklärt, kann es gemäß § 48 Abs. 3 BVerfGG im Falle eines Wahlfehlers zumindest feststellen, dass Rechte der wahlberechtigten Person oder Gruppe von Personen verletzt wurden. Insoweit muss es sich dann um eigene Rechte der jeweiligen Person oder Personen handeln.
In der Geschichte der Bundesrepublik ist noch keine Bundestagswahl und bisher nur eine landesweite Wahl für ungültig erklärt worden. Das Hamburger Verfassungsgericht 120nahm wegen Verstoßes einer Partei gegen die Grundsätze einer demokratischen Wahl bei der innerparteilichen Aufstellung der Wahlkandidaten nicht nur – zutreffend – einen Wahlfehler an, sondern bejahte auch dessen Mandatsrelevanz für die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses insgesamt mit der Folge von dessen Auflösung. Das Urteil ist wegen der Annahme dieser einschneidenden Rechtsfolge scharf kritisiert worden. In der Tat erscheint es problematisch, dass eine Partei durch innerparteiliche Organisationsfehler, die vom Wahlleiter unbeanstandet geblieben sind, eine Wahl ungültig machen kann. Darüber hinaus ließ sich eine Mandatsrelevanz mit Auswirkungen auf das gesamte Parlament tatsächlich auch in diesem Fall nicht überzeugend begründen. 121
Literatur: G. Robbers , Verfassungsprozessuale Probleme in der öffentlich-rechtlichen Klausur, JuS 1994, 854 (856 f.); G. Roth , Zur Durchsetzung der Wahlrechtsgrundsätze vor dem Bundesverfassungsgericht, DVBl. 1998, 214.
Fallbearbeitungen: F. Shirvani/M. Schröder , „Unregelmäßigkeiten bei der Bundestageswahl“, Jura 2007, 143 (Wahlprüfungsbeschwerde).
Lösung zu Fall 2: Sperrklausel 122
W könnte gegen die Entscheidung des Bundestages Wahlprüfungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht einlegen. Eine Wahlprüfung durch den Bundestag, der hierfür nach § 26 Abs. 2 EuWahlG zuständig ist, hat sie bereits veranlasst, ist damit aber erfolglos geblieben. Gegen die Entscheidung des Bundestages ist gemäß § 26 Abs. 3 Satz 1 EuWahlG die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig. 123
Die Wahlprüfungsbeschwerde von W hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.
I.Zulässigkeit
Die Zulässigkeit einer Wahlprüfungsbeschwerde bestimmt sich im Falle der Überprüfung einer Wahl zum Europäischen Parlament nach § 26 Abs. 3 EuWahlG.
1. Beschwerdegegenstand.Die Wahlprüfungsbeschwerde ist gemäß § 26 Abs. 3 Satz 1 EuWahlG taugliches Rechtsmittel gegen den Beschluss des Bundestages über die Gültigkeit einer Wahl. W wendet sich hier gegen den Beschluss des Bundestages, mit dem dieser ihren Einspruch gegen die Anwendung der 3 %-Sperrklausel bei der Umrechnung der abgegebenen Wählerstimmen auf die Verteilung der Mandate zurückgewiesen hat. Darin liegt gleichzeitig die Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl. Es handelt sich um einen tauglichen Beschwerdegegenstand.
2. Beschwerdeführer.Gemäß § 26 Abs. 3 Satz 2 EuWahlG sind wahlberechtigte Personen, deren Einspruch vom Bundestag verworfen wurde, zur Wahlprüfungsbeschwerde berechtigt. Die Möglichkeit einer Verletzung in eigenen Rechten muss nicht geltend gemacht werden. W ist taugliche Beschwerdeführerin.
3. Antragsform.Gemäß § 26 Abs. 3 Satz 3 EuWahlG iVm. § 23 Abs. 1 BVerfGG muss die Wahlprüfungsbeschwerde schriftlich und mit einer Begründung versehen (§ 26 Abs. 3 Satz 2 aE. EuWahlG) beim Bundesverfassungsgericht eingehen. Diese Begründung muss so hinreichend substantiiert sein, dass sich aus ihr der Wahlfehler und die Mandatsrelevanz dieses Fehlers erkennen lassen. 124W macht die Verfassungswidrigkeit der Sperrklausel geltend, deren Mandatsrelevanz offensichtlich ist. Dem Begründungserfordernis ist genügt.
4. Beschwerdefrist.Die Beschwerde muss gemäß § 26 Abs. 3 Satz 2 EuWahlG innerhalb von zwei Monaten seit Beschlussfassung des Bundestages beim Bundesverfassungsgericht erhoben und begründet werden. Die Frist beginnt erst mit der Zustellung des Beschlusses mit Rechtsbehelfsbelehrung (vgl. § 26 Abs. 2 EuWahlG iVm. § 13 Abs. 3 WahlPrG).
5. Zwischenergebnis.Bei Wahrung der Frist ist die Wahlprüfungsbeschwerde zulässig.
II.Begründetheit
Die Wahlprüfungsbeschwerde ist begründet, wenn der Beschluss des Bundestages formell und/oder materiell rechtswidrig ist. Die Rechtsfolge im Falle eines Rechtsverstoßes hängt entscheidend von dessen Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Parlaments (Mandatsrelevanz) ab. Im konkreten Fall könnte sich der Verstoß zudem bereits daraus ergeben, dass der Gesetzgeber die gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG bestehende Bindungswirkung des Urteils vom 26. Februar 2014 (BVerfGE 135, 259 ff.) ignoriert hat, wonach eine 3 %-Sperrklausel unzulässig ist.
1. Bindungswirkung des bundesverfassungsgerichtlichen Urteils.Die erneute Einführung der 3 %-Sperrklausel verstößt gegen die Bindungswirkung des bundesverfassungsgerichtlichen Urteils, wenn sich weder die rechtlichen noch die tatsächlichen Umstände geändert haben. In rechtlicher Hinsicht hat der Europäische Gesetzgeber inzwischen eine Sperrklausel mit einer Spanne von 2 %–5 % eingeführt. In tatsächlicher Hinsicht haben die vorangegangenen Wahlen zum Europäischen Parlament gezeigt, dass das Fehlen einer Sperrklausel zu einer Verdoppelung der im Europäischen Parlament vertretenen deutschen Parteien geführt hat, was erheblich zur Zersplitterung des Europäischen Parlaments beiträgt. Das Bundesverfassungsgericht hat selbst ausgeführt, dass sich eine abweichende verfassungsrechtliche Beurteilung ergeben kann, wenn sich die Verhältnisse wesentlich ändern. Für solche Änderungen liegen Anhaltspunkte vor. Damit ist das Gesetz nicht bereits wegen Verstoßes gegen die Bindungswirkung ungültig.
2. Prüfung der formellen Rechtswidrigkeit.Der Bundestag ist gemäß § 26 Abs. 1 und 2 EuWahlG iVm. § 1 Abs. 1 Wahlprüfungsgesetz für die Prüfung der Gültigkeit der Wahlen zum Europäischen Parlament zuständig.
Gemäß § 26 Abs. 2 EuWahlG gelten für das Wahlprüfungsverfahren die Bestimmungen des Wahlprüfungsgesetzes mit wenigen hier nicht relevanten Ausnahmen entsprechend. Verfahrens- (§ 2 ff. Wahlprüfungsgesetz) oder Formfehler (§§ 11 Abs. 1 Satz 1, 13 Abs. 3 Wahlprüfungsgesetz) sind nicht geltend gemacht und nicht ersichtlich.
Читать дальше