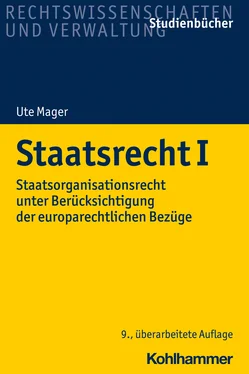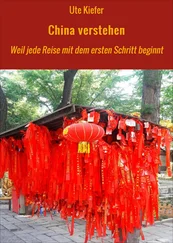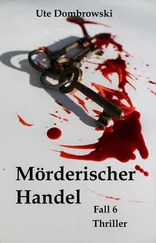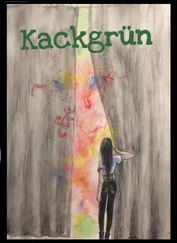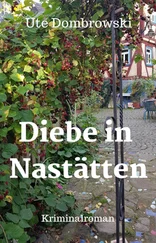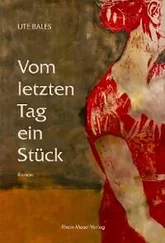5. Kapitel:Bedeutende Verfassungsänderungen infolge und nach der Wiedervereinigung
5.1Die Ergebnisse der Arbeit der Gemeinsamen Verfassungskommission
54Der Einigungsvertrag enthielt in seinem Art. 5 die Empfehlung an die gesetzgebenden Körperschaften des vereinten Deutschlands, sich innerhalb von zwei Jahren „mit den im Zusammenhang mit der deutschen Einigung aufgeworfenen Fragen zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes zu befassen“. Als Gegenstände nennt Art. 5 EV insbesondere das Verhältnis zwischen Bund und Ländern, die Neugliederung im Raum Berlin/Brandenburg, die Aufnahme von Staatszielbestimmungen sowie die Frage der Anwendung von Art. 146 GG, der die Geltung des Grundgesetzes auf den Tag befristet, an dem „eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ Nachdem der große Schritt der Wiedervereinigung als Beitritt gemäß Art. 23 GG aF. vollzogen war, sprach jedoch nichts mehr für die Notwendigkeit, die verfassungsgebende Gewalt zu aktivieren, zumal das Grundgesetz im Ganzen akzeptiert war, wenn nicht gar identitätsstiftend wirkte.
55Auf Grund der Empfehlung in Art. 5 EV bildeten Bundestag und Bundesrat im Jahre 1992 eine aus je 32 Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates zusammengesetzte Gemeinsame Verfassungskommissionund erteilten ihr den Auftrag, Vorschläge für Verfassungsänderungen zu erarbeiten. 1Innerhalb der Kommission war mit 2/3-Mehrheitzu entscheiden. Für das Verfahren galt die Geschäftsordnung des Bundestages.
Von den vielen Reformvorschlägen in den Beratungen fanden nur wenige die erforderliche 2/3-Mehrheit. Von der Kommission beschlossen und in den Verfassungstext eingegangen sind die Ergänzung des Art. 3 Abs. 2 GG um die Verpflichtung zur Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigungvon Frauen und Männern (Satz 2) und des Art. 3 Abs. 3 GG um ein Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung(Satz 2), die Aufnahme des Staatsziels Umweltschutz(Art. 20a GG), die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltungdurch Einbeziehung der Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung (Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG), die Erleichterung der Neugliederungder Länder (Neufassung des Art. 29 GG und Einfügung von Art. 118a GG betr. Berlin und Brandenburg) sowie eine Stärkung der Gesetzgebungskompetenzen der Länder(Änderung von Art. 72, 74 und 75 GG).
Insgesamt mündete die angestrebte Verfassungsreform in eine Summe einzelner Verfassungsänderungen. Da es in Bezug auf die Gesamtverfassung an echter Reformnotwendigkeit fehlte und die erforderliche 2/3-Mehrheit eine erhebliche Hürde für Änderungen errichtete, kann das letztlich bescheidene Ergebnis nicht verwundern, zumal die drängendsten Änderungen infolge der europäischen Integration bereits vorab realisiert worden waren.
5.2Europäische Integration
56Die Integration in die Gemeinschaft der Europäischen Staaten ist für die gesamte politische Entwicklung Deutschlands seit der Nachkriegszeit von größter Bedeutung. Insofern erwies es sich als vollkommen stimmig, dass die Wiedervereinigung zeitlich aufs Engste mit der qualitativ neuen Stufe der europäischen Integration zusammenfiel, die der Vertrag von Maastricht 2markiert. Er intensivierte die Europäischen Gemeinschaften zu einer Wirtschafts- und Währungsunionund ergänzte diese um weitere Felder der Zusammenarbeit, namentlich die Außen- und Sicherheitspolitiksowie die Bereiche Justiz und Inneres, die allerdings auf intergouvernementaler 3Basis verblieben.
Mit dem Vertrag von Maastricht hatte die europäische Integration eine Intensität erreicht, die es geraten erscheinen ließ, die Ratifikation des Vertrages nicht mehr wie bisher auf der Grundlage von Art. 24 Abs. 1 GG vorzunehmen, wonach der Bund durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen kann, sondern Grundlagen und Grenzen der Integration speziell in der Verfassung auszuweisen. Dies war umso mehr geboten, als die Verfassungsmäßigkeit der Gründung einer Wirtschafts- und Währungsunion angezweifelt und gerügt wurde, dass die europäische Integration nunmehr ein Ausmaß erreicht habe, welches die staatlichen Entscheidungsbefugnisse substanziell aushöhle. Das Bundesverfassungsgericht stellte in seiner bedeutenden Maastricht-Entscheidung fest, dass das Demokratieprinzip die Bundesrepublik Deutschland nicht an einer Mitgliedschaft in einer supranational organisierten zwischenstaatlichen Gemeinschaft hindere. Voraussetzung sei aber, dass eine vom Volk ausgehende Legitimation und Einflussnahme auch innerhalb des Staatenverbundes gesichert sei. 4
57Als Grundlage für den Vertrag von Maastricht und alle zukünftigen Integrationsschritte wurde Art. 23 GGneu eingefügt. Der Artikel enthielt zuvor die Grundlage der Wiedervereinigung und war mit deren Vollendung (passenderweise) frei geworden. Art. 23 Abs. 1 GG nF. bestimmt, dass die Bundesrepublik zur Verwirklichung eines vereinten Europas bei der Entwicklung der Europäischen Union mitwirkt, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiaritätverpflichtet ist und einen dem Grundgesetz im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Artikel enthält weitere Regelungen über die Mitwirkung von Bundestag und Bundesrat in Angelegenheiten der Europäischen Union, für die entsprechende Ausschüsse eingerichtet wurden (Art. 45 und 52 Abs. 3a GG). In Umsetzung des Vertrags von Maastricht fand außerdem das kommunale Wahlrecht für nichtdeutsche Unionsbürger Eingang in die Verfassung, und es wurde die notwendige Ermächtigung zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen der Deutschen Bundesbank auf die Europäische Zentralbank geschaffen (Art. 88 Satz 2 GG).
58Bis zur Föderalismusreform im Jahre 2006 erfuhr das Grundgesetz vor allem im Grundrechtsteil weitere Änderungen, von denen die Zulassung von Frauen zum Militärdienst (Art. 12a Abs. 4 Satz 2 GG) auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum gemeinschaftsrechtlichen Gebot der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Arbeitsleben 5zurückgeht. In europäischem Zusammenhang steht auch die Einschränkung des Asylrechts durch das 47. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 29. November 2000. 6
59Das 52. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 7, das in seinen wesentlichen Teilen zum 1. September 2006 in Kraft trat, bildete den ersten Teil der Föderalismusreform. Die besonders schwierige Reform der Finanzverfassung wurde auf den zweiten Teil verschoben.
60Am 16. und 17. Oktober 2003 fassten Bundestag und Bundesrat den Beschluss, eine gemeinsame Kommission einzusetzen mit der Aufgabe, Vorschläge zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnungzu erarbeiten. 8Die Vorschläge sollten darauf zielen, die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit von Bund und Ländern zu verbessern, die politischen Verantwortlichkeiten deutlicher zuzuordnen sowie die Zweckmäßigkeit und Effizienz der Aufgabenerfüllung zu steigern. Diese Zielsetzungen verdeutlichen gleichzeitig die Gründe für die Reform. Außerdem sollte der weiteren Entwicklung der Europäischen Union sowie der Stellung der Kommunen Rechnung getragen werden. 9Auf dem Prüfstand standen die Verteilung der Gesetzgebungszuständigkeiten, die Mitwirkungsrechte der Länder an der Bundesgesetzgebung sowie in Bezug auf die Finanzbeziehungen insbesondere die Mischfinanzierungstatbestände gemäß Art. 91a und b sowie Art. 104a Abs. 4 GG aF.
Читать дальше