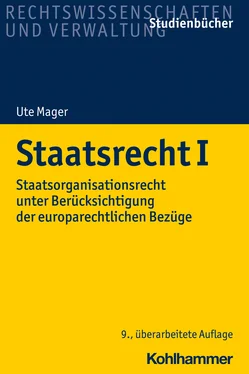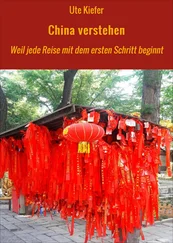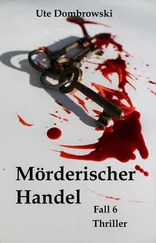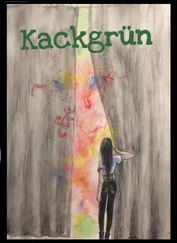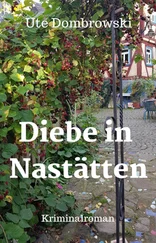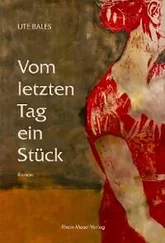1 ...7 8 9 11 12 13 ...40
3. Kapitel:Bedeutende Verfassungsänderungen vor der Wiedervereinigung
38Bis zur Wiedervereinigung erfuhr das Grundgesetz 35 Änderungen. Die wichtigsten standen in Zusammenhang mit den Aufhebungen der Souveränitätsbeschränkungen oder betrafen die Beziehungen zwischen Bund und Ländern. 1
3.1Wehrverfassung 1954/56
39Da Deutschland infolge des verlorenen Krieges entmilitarisiert und eine Wiederbewaffnung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Grundgesetzes nicht absehbar war, enthielt die Verfassung zunächst keine Bestimmungen über die Aufstellung und Verwendung von Streitkräften. Infolge des aufbrechenden Ost-West-Konflikts erschien den Westalliierten jedoch schon bald eine Wiederbewaffnung der Bundesrepublik bei gleichzeitiger Integration in eine europäische Verteidigungsgemeinschaft wünschenswert. Im Vertrag über die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland mit den drei Mächten (Deutschlandvertrag )von 1951/53 2vereinbarten die Vertragsparteien daher zunächst mit Blick auf die Gründung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, nach deren Scheitern mit Blick auf den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur NATO 3, die Aufhebung des Besatzungsstatuts. Alliierte Vorbehalte bezogen sich nunmehr nur noch auf Berlin, die Wiedervereinigung und auf einen Friedensvertrag. Damit war der Weg frei für die Aufstellung von Streitkräften. Mit dem 4. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 26. März 1954 4und dem 7. Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes vom 19. März 1956 5fanden – nach heftigem innenpolitischen Streit 6– die wehrverfassungsrechtlichen Vorschriften Eingang in die Verfassung. Dies betraf insbesondere die Regelung der Wehrpflichtin Art. 12a GG, die Einrichtung eines parlamentarischen Verteidigungsausschusses und eines Wehrbeauftragten (Art. 45a und 45b GG), die Regelung der Befehls- und Kommandogewalt nach Art. 65a GG und die Bestimmungen über die Streitkräfte und ihre Verwaltung in Art. 87a und 87b GG.
3.2Notstandsverfassung 1968
40Vervollständigt wurden die Regelungen der Wehrverfassung durch das 17. Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes vom 24. Juni 1968 7, die sog. Notstandsverfassung. Der neu eingefügte Abschnitt Xa mit den Art. 115a–115l GG regelt unter der Überschrift „Verteidigungsfall“ ausführlich den äußeren Notstand, insbesondere die Modifikationen in den Zuständigkeiten der obersten Staatsorgane. Die Vorschriften zum inneren Notstandfinden sich in Art. 35 Abs. 2 und 3 sowie Art. 87a Abs. 4 und Art. 91 GG. Da manche in den Bestimmungen der Notstandsverfassung die Gefahr eines Übergangs zur Diktatur sahen, wurde außerdem Art. 20 GG um die Regelung eines Widerstandsrechtsergänzt. Dessen Ausübung ist an die vorherige Ausschöpfung (zumindest) des Rechtswegs geknüpft. Gibt es keine rechtsstaatliche Gerichtsbarkeit mehr, hat das GG allerdings bereits seine Verbindlichkeit verloren und kann damit auch den Widerstand nicht mehr als verfassungsmäßig deklarieren. Gibt es eine rechtsstaatliche Gerichtsbarkeit, ist „andere Abhilfe“ möglich. Art. 20 Abs. 4 GG ist deshalb – zukunftsgerichtet – ein Fall symbolischer Gesetzgebung; auf die Vergangenheit bezogen, enthält er die Rechtfertigung und Anerkennung der Widerstandskämpfer im Dritten Reich.
41Besonders umstritten war die im Zusammenhang mit der Notstandsverfassung vorgenommene Änderung des Art. 10 GG. 8Danach kann ein Gesetz bestimmen, dass Eingriffe in das Brief-, Post- oder Fernmeldegeheimnis dem Betroffenen nicht mitgeteilt werden müssen, wenn die Beschränkung dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes dient. Der damit ausgeschlossene individuelle Rechtsschutz gegen derartige Maßnahmen – der eine Ergänzung der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG um einen Hinweis auf die Ausnahme des Art. 10 Abs. 2 Satz 2 GG notwendig machte – wird kompensiert durch eine parlamentarische Kontrolle.
3.3Bundesstaatliche Kompetenzverteilung und Finanzreform
42Eine Vielzahl von Verfassungsänderungen betraf die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländernin Bezug auf neu auftretende Aufgaben wie etwa den Umweltschutz 9, die friedliche Nutzung der Kernenergie 10oder die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser. 11
43Gegenstand zahlreicher Änderungen waren auch die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Von besonderer Bedeutung und besonders umstritten war das 21. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes, das Finanzreformgesetzvom 12. Mai 1969. Es reagierte darauf, dass die Länder für eine Vielzahl von Investitionsaufgaben finanziell nicht hinreichend ausgestattet waren. Bestimmungen über die gemeinsame Planung und Finanzierung derartiger „Gemeinschaftsaufgaben“ in einem neuen Abschnitt VIIIa (Art. 91a und 91b GG) sowie eine grundlegende Regelung über die Ausgabenzuständigkeit einschließlich einer Investitionshilfekompetenz des Bundes sollte den entstandenen Wildwuchs an Bundesförderungen und Mischfinanzierungen verfassungsrechtlich bändigen. 12Der Sinn und Nutzen dieser Bestimmungen war unter den Stichworten kooperativer Föderalismuseinerseits, Politikverflechtungandererseits von Anfang an umstritten. 13Die Vorschriften sind inzwischen erneut mehrfach geändert worden. Zuvor jedoch hinterließen die Wiedervereinigung und die fortschreitende europäische Integration ihre Spuren im Grundgesetz.
Literatur: E. Barth , 10 Jahre Wehrverfassung, DÖV 1966, 153; G. Robbers , Die Änderungen des Grundgesetzes, NJW 1989, 1325.
4. Kapitel:Wiedervereinigung
4.1Das geteilte Deutschland
44Mit der Errichtung zweier Verfassungsordnungen auf deutschem Boden stellte sich von Anfang an die Frage nach dem Verhältnisder Bundesrepublik und der DDR zum gesamtdeutschen Staat wie auch nach dem Verhältnis beider Teile zueinander. In der Phase des Kalten Krieges erhoben beide Seiten zunächst einen Alleinvertretungsanspruch. Im Zuge der „neuen Ostpolitik“ gab die Bundesregierung den Alleinvertretungsanspruch auf. In ihrer Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 sprach sie von den „zwei Staaten in Deutschland“. 1Nach dieser Auffassung war die DDR im Verhältnis zur Bundesrepublik kein Ausland; die DDR war aber im Verhältnis zur Bundesrepublik auch kein Inland, da der Geltungsbereich des Grundgesetzes gemäß Art. 23 Satz 1 GG in der damals geltenden Fassung sich nur auf die damaligen Länder der Bundesrepublik erstreckte. Die Beziehungen zwischen Bundesrepublik und DDR wurden daher als „Beziehungen besonderer Art“bezeichnet. Wenn Bundesgesetze die Begriffe „Inland“ und „Ausland“ verwendeten, war jeweils durch Auslegung festzustellen, ob damit das Gebiet der DDR gemeint sein konnte oder nicht. 2
45Der Normalisierung der Beziehungenzueinander diente der „Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik“ ( Grundlagenvertrag) vom 21. Dezember 1972. 3Inhalt des Grundlagenvertrages war insbesondere: die Entwicklung normaler gutnachbarlicher Beziehungen, der Grundsatz, dass die Hoheitsgewalt jedes der beiden Staaten sich auf sein Hoheitsgebiet beschränkt, ein Bekenntnis zu friedlicher Streitbeilegung und zur Unverletzlichkeit der zwischen ihnen bestehenden Grenzen.
Der Grundlagenvertrag war politisch und rechtlich umstritten. Die Bayerische Staatsregierung war der Auffassung, der Vertrag verletze ua. das Gebot der Wahrung der staatlichen Einheit Deutschlands, das Wiedervereinigungsgebot und die Schutz- und Fürsorgepflicht gegenüber Deutschen in der DDR; sie rief daher im Wege der abstrakten Normenkontrolle (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG) das Bundesverfassungsgerichtmit dem Ziel an, das vom Bundestag beschlossene Vertragsgesetz zum Grundlagenvertrag für mit dem GG unvereinbar und deshalb nichtig zu erklären. Das Bundesverfassungsgericht befand den Grundlagenvertragfür verfassungsgemäß. 4Die Entscheidungsgründeenthalten grundlegende Ausführungen zum Fortbestand des deutschen Staates und zum Verhältnis der Bundesrepublik zur DDR 5:
Читать дальше