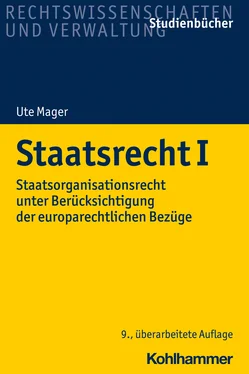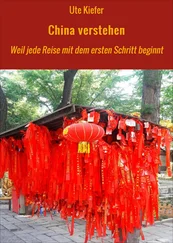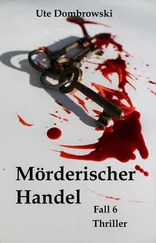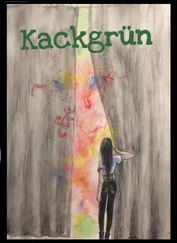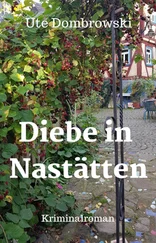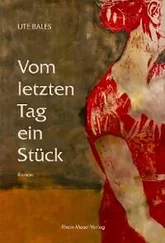24Die freiheitlich-demokratischen sowie nationalstaatlichen Bestrebungen 9in der Bevölkerung der deutschen Monarchien und Fürstentümer brachen sich, ermutigt durch die revolutionären Ereignisse in Frankreich im Februar 1848, in der sog. MärzrevolutionBahn. 10In einer Vielzahl von deutschen Staaten kam es zu verfassungsgebenden Versammlungen. 11Als Ergebnis der revolutionären Ereignisse fand am 1. Mai 1848 in den deutschen Staaten die Wahl zur Nationalversammlungstatt, die am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirchezusammentrat. Sie beschloss am 27. Dezember 1848 zunächst das „Gesetz betreffend die Grundrechte des deutschen Volkes“. 12Der Beschluss über die gesamte deutsche Reichsverfassung vom 28. März 1849 trat nicht in Geltung, weil der zum Staatsoberhaupt ausersehene preußische König Friedrich Wilhelm IV. eine Kaiserkrone aus den Händen des Volkes ablehnte und im weiteren Verlauf der geschichtlichen Ereignisse die Fürsten die Oberhand zurückerlangten (sog. Gegenrevolution). 13Zum Scheitern der Paulskirchenverfassung trug auch bei, dass die Gründung eines deutschen Bundesstaates den Vielvölkerstaat Österreich vor die faktisch unmögliche Entscheidung stellte, „in das Reich unter Preisgabe der staatlichen Einheit“ einzutreten oder die „staatliche Einheit unter Ausscheiden aus dem Reich“ zu bewahren 14(Streit um die großdeutsche oder kleindeutsche Lösung). 15
Obwohl die Paulskirchenverfassung niemals staatsrechtlich wirksam wurde, entfaltete sie als erste „vollentwickelte Konzeption einer deutschen Gesamtstaatsverfassung“ 16eine kaum zu überschätzende Vorbildwirkung für die weitere Verfassungsentwicklung. Dies gilt vor allem für das Verhältnis von Reich und Ländern, die Repräsentation der Länder im Bund, das Verhältnis von Staatsoberhaupt, Regierung und Parlament zumindest bis zur Weimarer Reichsverfassung sowie für die Grundrechtsentwicklung. 17
25Die Reichsverfassung von 1871, mit der die staatliche Einheit schließlich verwirklicht wurde, enthielt keine Grundrechte. 18Gemäß der damals herrschenden rechtspositivistischen Auffassung banden die Grundrechte allein die vollziehende Gewalt 19, die nach der Reichsverfassung im Wesentlichen den Ländern oblag. 20In deren Verfassungen fanden sich dann auch Grundrechtsverbürgungen.
1.3Die Weimarer Reichsverfassung
26Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg und der Novemberrevolution von 1918 verlor die Reichsverfassung von 1871 ihre Gültigkeit. Am 19. Januar 1919 wurde nach den Grundsätzen der allgemeinen, gleichen und geheimen Wahl die Nationalversammlunggewählt, die am 6. Februar 1919 im Nationaltheater in Weimarzusammentraf. Auf der Grundlage eines Entwurfs des Staatsrechtslehrers Hugo Preuß beriet die Versammlung über die Reichsverfassung, die mit erheblichen Abweichungen 21von diesem Entwurf am 31. Juli 1919 beschlossen und am 11. August 1919 verkündet wurde. 22
27Gemäß Art. 1 Satz 1 WRV war das Deutsche Reich eine Republik; Art. 1 Satz 2 WRV bestimmte, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Die Bundesstaatsstruktur zeigte starke zentralistische Tendenzen. Die Regierung war zwar dem Parlament verantwortlich (parlamentarische Demokratie), war jedoch letztlich vom Wohlwollen des Reichspräsidenten abhängig, der sie ohne Mitwirkung des Reichstags ernannte (Art. 43 WRV). Die starke Stellung des Reichspräsident en, konzipiert in Anlehnung an die Stellung des Kaisers, zeigte sich auch in seinem Recht, den Reichstag aufzulösen (Art. 25 WRV) sowie in seinem Notverordnungsrecht gemäß Art. 48 Abs. 2 WRV, von dem die Reichspräsidenten ausgiebig Gebrauch machten. 23Während Reichspräsident und Reichsregierung also in der Lage waren, ohne das Parlament zu regieren, wurde dessen politische Handlungsfähigkeit dadurch gehemmt, dass die politischen Differenzen in der Gesellschaft sich gemäß dem verfassungsrechtlich verankerten reinen Verhältniswahlrecht(Art. 22 WRV) ungehemmt im Reichstag auswirken konnten. Die Verbindlichkeit der Verfassung schließlich bestand gegenüber dem Gesetzgeber nur eingeschränkt. Zum einen waren nach der herrschenden rechtspositivistischen Lehre die unter einem Gesetzesvorbehalt stehenden Grundrechte der beliebigen Beschränkung durch Gesetz ausgeliefert. 24Zum anderen enthielt die Weimarer Reichsverfassung keinerlei inhaltliche Vorkehrungen gegen Verfassungsänderungen. Sofern nur die nötige 2/3-Mehrheit von mindestens 2/3 der gesetzlichen Mitgliederzahl erreicht war und der Reichsrat keinen Einspruch erhob (Art. 76 WRV), war jegliche Verfassungsdurchbrechung 25möglich. Auf diese Weise konnte der Reichstag sich durch Ermächtigungsgesetze, schließlich durch das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich 26selbst entmachten.
28Die Weimarer Reichsverfassung war nicht in der Lage, die freiheitliche Demokratie in einer außerordentlich schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage gegenüber extremen und totalitären Kräften zu bewahren. Ob eine andere Verfassung die Katastrophe des Nationalsozialismus hätten abwenden können, lässt sich nicht beantworten. Sicher ist, dass das Grundgesetz in einer Vielzahl seiner Bestimmungen Lehren aus den Erfahrungen der Weimarer Republik und ihrem Untergang ziehen will und die Schwächen der Weimarer Reichsverfassung zu vermeiden sucht. 27
Literatur: Ch. Bickenbach , Totenschein für die Weimarer Republik, Recht und Politik 2013, 107; D. Bock , Der deutsche Konstitutionalismus im 19. Jahrhundert – ein Überblick, JA 2005, 363; F. Hammer , Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 – die Weimarer Reichsverfassung, Jura 2000, 57; M. Jäkel , Die „Paulskirchenverfassung“ der Frankfurter Nationalversammlung, Jura 2019, 231; A. Laufs , Die Frankfurter Nationalversammlung 1848/1849 – Das erste frei gewählte gesamtdeutsche Parlament und sein Werk, JuS 1998, 385; W. Pöggeler/J. Inhoff , Die deutsche Revolution 1848/49, JA 1998, 311; G. Roellecke , Von Frankfurt über Weimar nach Bonn und Berlin, JZ 2000, 113; Ch. Waldhoff , „Weimar“ als Argument, JuS 2019, 737.
Vertiefende Literatur: W. Apelt , Geschichte der Weimarer Verfassung, 2. Aufl. 1964; E.-W. Böckenförde (Hrsg.) , Moderne deutsche Verfassungsgeschichte, 2. Aufl. 1981; W. Frotscher/B. Pieroth , Verfassungsgeschichte, 18. Aufl. 2019; Ch. Gusy , Die Weimarer Reichsverfassung, 1997; E.-R. Huber , Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bände 1–4, 1975–1981; M. Kotulla , Deutsche Verfassungsgeschichte, 2008; C.-F. Menger , Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 8. Aufl. 1993; M. Stolleis , Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Band 2: Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft: 1800–1914, 1992; D. Willoweit/S. Schlinker , Deutsche Verfassungsgeschichte, 8. Aufl. 2019.
2. Kapitel:Entstehungsgeschichte
2.1Kapitulation
29Unter der Herrschaft des Nationalsozialismus hatte Deutschland den Zweiten Weltkrieg ausgelöst und im Mai 1945 endgültig verloren. Schon vor dem Ende der Kriegshandlungen hatten die Alliierten die Teilung Deutschlands beschlossen. Im Londoner Protokoll betreffend die Besatzungszonen in Deutschland und die Verwaltung von Groß-Berlinvom 12. September 1944 hieß es dazu: „Deutschland, in den Grenzen vom 31. Dezember 1937, wird für die Zwecke der Besatzung in drei Zonen geteilt und in ein spezielles Gebiet Berlin, das unter der gemeinsamen Verwaltung der drei Mächte stehen wird.“ 1Auf der Konferenz von Jaltavom 4.–11. Februar 1945 wurde die Aufteilung Deutschlands bestätigt und als vierte Besatzungszone die französische Zone vorgesehen. 2
Читать дальше