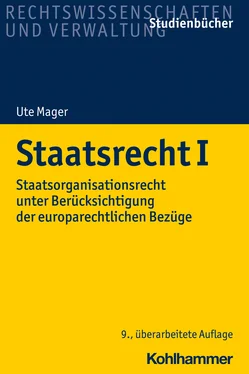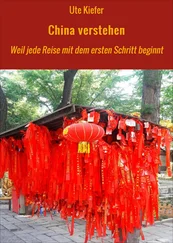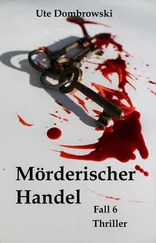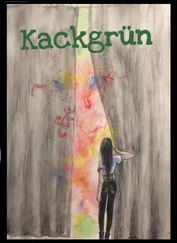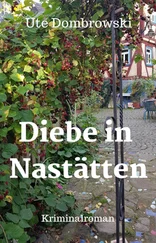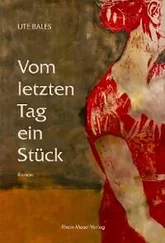7Der Begriff des Verfassungsrechtswird vielfach identisch mit dem Begriff des Staatsrechts gebraucht (materielles Verständnis). 13Zuweilen bezeichnet er nur das in der jeweiligen Verfassungsurkunde niedergelegte Staatsrecht (formelles Verständnis). 14Soweit der Begriff auf den Inhalt einer Verfassungsurkunde verweist, kann er auch vollkommen vom Staatsbegriff gelöst werden 15: Die Verwendung des Verfassungsbegriffs reicht von der Betriebsverfassung über die Kommunalverfassung und die Verfassung der Europäischen Union 16bis hin zur Verwendung des Verfassungsbegriffs im Völkerrecht. 17
8Das Herzstück des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland findet sich im Grundgesetz, erschöpft sich darin aber nicht, geht also über das Verfassungsrecht im formellen Sinne hinaus. Einfache Gesetze, die staatsrechtliche Regelungen enthalten, sind etwa das Staatsangehörigkeitsgesetz, das Bundeswahlgesetz, das Gesetz über die Wahl des Bundespräsidenten, das Bundesministergesetz oder das Abgeordnetengesetz. Auch Geschäftsordnungen können staatsrechtlichen Inhalt haben, etwa die Geschäftsordnungen des Bundestages, des Bundesrates oder der Bundesregierung. Ganz überwiegend finden sich entsprechende Rechtssetzungsbefugnisse in der Verfassungsurkunde selbst, 18worin sich die grundlegende Funktion der Verfassung für die gesamte Rechtsordnung zeigt.
9Festzuhalten ist, dass das Staatsorganisationsrecht der Teil des Staatsrechts und damit des Öffentlichen Rechts ist, der sich mit den grundlegenden Entscheidungen über die Konstituierung der Staatsorgane, deren Aufgaben und Rechtsverhältnisse untereinander sowie den Staatsfunktionen und deren Kontrolle befasst.
10Erkenntnisziel der Rechtswissenschaft als Rechtsdogmatik 19ist es, den Sinn von Rechtssätzen zu ermitteln. Diese Frage stellt sich im Hinblick auf den Sinnzusammenhang innerhalb einer Rechtsordnung wie auch im Hinblick auf den Sinn (die Bedeutung) eines Rechtssatzes in Bezug auf ein konkretes Problem. 20Mit der Frage nach Sinn und Bedeutung eines von Menschen geschaffenen Gegenstandes erweist sich die Rechtswissenschaft als eine hermeneutische Wissenschaft. Hermeneutik ist die Lehre vom Sinnverstehen. Rechtsdogmatik ist Bestandteil der Rechtswissenschaft, weil und soweit sie ergebnisoffen mit rational nachvollziehbaren Methoden nach dem Sinn von Rechtssätzen fragt. 21Da ihr Gegenstand das geltende Recht ist, ist sie von herausragender Bedeutung für Ausbildung und Praxis. Die anderen Disziplinen der Rechtswissenschaft werden insoweit richtig als Grundlagenfächer bezeichnet, als sie die historischen, philosophischen, soziologischen und theoretischen Grundlagen vermitteln, die einen kritischen Umgang mit dem geltenden Recht ermöglichen, zu seinem richtigen Verständnis beitragen und es für neue Entwicklungen offenhalten.
11Den für die Rechtswissenschaft (Rechtsdogmatik) klassischen Kanon von Auslegung smethodenhat Friedrich Carl von Savigny (1779–1861) formuliert. 22Ausgangsbasis und Grenze der Auslegung ist der Wortlauteines Rechtssatzes. Die verwendeten Begriffe sind jedoch in der Regel unscharf. Dies zeigt sich selbst bei vermeintlich eindeutigen Bestimmungen angesichts konkreter Streitfälle, die den Text zum Problem werden lassen.
So stellte sich etwa angesichts der Vertrauensfragen von Bundeskanzler Kohl und später von Bundeskanzler Schröder auf der Grundlage des Art. 68 Abs. 1 GG das Problem, ob diese Frage rein formal und mit dem Ziel, die Rechtsfolge der Parlamentsauflösung herbeizuführen, gestellt werden darf oder ob sie wahrhaftig auf die parlamentarische Bestätigung des Vertrauens in den Kanzler gerichtet sein muss. 23Auch der Wortlaut des Art. 22 Abs. 2 GG: „Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.“ ist nicht eindeutig, denn er sagt nichts über die Anordnung der Farben, etwa ob es sich um Kreise oder Farbstreifen handelt, um eine horizontale oder vertikale Ausrichtung.
Um die Mehr- bzw. Vieldeutigkeit von Begriffen zu reduzieren, kommen als weitere Auslegungsmethoden die systematische, die teleologische und die historische Auslegung zur Anwendung.
12Die systematische Auslegungfragt nach dem Sinn des Wortlauts im Zusammenhang mit dessen Stellung im Gesetz als Ganzes. So folgt etwa aus der Bindung des Gesetzgebers an die Grundrechte gemäß Art. 1 Abs. 3 GG, dass der Begriff „Akt der öffentlichen Gewalt“ im Zusammenhang mit der Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG Parlamentsgesetze umfasst. Aus dem Verwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts für Parlamentsgesetze (Argument aus Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, Art. 100 GG) ergibt sich demgegenüber, dass Rechtsschutz durch die in Art. 19 Abs. 4 GG angesprochene Gerichtsbarkeit nicht auf die Nichtigerklärung von Parlamentsgesetzen gerichtet sein kann; der Begriff der „öffentlichen Gewalt“ im Sinne des Art. 19 Abs. 4 umfasst daher, trotz gleichen Wortlauts, Legislativakte nicht. 24
13Von großer Bedeutung ist die teleologische Auslegung, die nach dem Sinn und Zweck einer Rechtsnorm fragt. Sinn und Zweck des Art. 19 Abs. 4 GG ist die Gewährleistung von Rechtsschutz durch Gerichte, also Richter. Würden Akte der Judikative zur öffentlichen Gewalt im Sinne des Art. 19 Abs. 4 GG gezählt, so führte dies zur Garantie eines Rechtsschutzes vor dem Richter, mit anderen Worten zur Garantie eines unendlichen Instanzenzuges. Daraus wird gefolgert, dass der Begriff „öffentliche Gewalt“ im Rahmen der Rechtsweggarantie ausschließlich Akte der vollziehenden Gewalt meint. 25
Als weiteres Beispiel lässt sich der Zweck des Art. 68 GG, auf Regierungsstabilität hinzuwirken, anführen, aus dem sich ein teleologisches Argument gegen eine rein formale Lesart des Vertrauensbegriffs im Rahmen der Vertrauensfrage des Bundeskanzlers und damit gegen dessen Umfunktionierung zu einem Instrument der Parlamentsauflösung gewinnen lässt. Einen Sonderfall systematisch-teleologischer Auslegung stellt es dar, wenn der Verfassung insgesamt ein Sinn und Zweck zugewiesen wird, in dessen Lichte alle Verfassungsnormen auszulegen sind. 26
14Innerhalb der historischen Auslegung ist die Entstehungsgeschichte (genetische Auslegung )und die Dogmengeschichte ( historische AuslegungieS.) zu unterscheiden. Die Entstehungsgeschichte fragt nach den Gründen und Umständen für den Erlass einer Norm. Sie hat eine Nähe zur subjektiven Auslegungsmethode, die nach dem Willen und den Vorstellungen des historischen Gesetzgebers fragt. Diese Auslegungsmethode kann von besonderem Respekt gegenüber dem parlamentarischen Gesetzgeber zeugen und insoweit besonders demokratisch sein; sie hat jedoch den Nachteil, dass tatsächliche Entwicklungen, die der historische Gesetzgeber nicht vorhergesehen hat, bei der Gesetzesauslegung unberücksichtigt bleiben. Das Bundesverfassungsgericht bevorzugt daher die objektive – an Wortlaut, Zusammenhang und Sinn orientierte – Auslegungsmethode, 27womit der Entstehungsgeschichte nur eine untergeordnete, bestätigende Rolle für die Sinnermittlung eines Rechtssatzes zukommt. Entsprechend größer ist der Einfluss der Rechtsprechung.
15Ebenfalls nur von untergeordneter Bedeutung ist in der Regel die historisch-dogmengeschichtlicheAuslegung. Sie beleuchtet eine Rechtsnorm im Lichte ihrer Vorläuferbestimmungen sowie der historischen Hintergründe. Letztere sind es, die aus der Bestimmung zur Bundesflagge gemäß Art. 22 Abs. 2 GG eine eindeutige Bestimmung machen. 28Für die historische Auslegung des Grundgesetzes sind insbesondere die Verfassung der Frankfurter Paulskirche von 1849 sowie die Weimarer Reichsverfassung zu berücksichtigen. 29In der noch jungen Bundesrepublik haben Verfassungsrechtsprechung und Verfassungsrechtswissenschaft das Grundgesetz vielfach im Lichte der Erfahrungen der Weimarer Republik interpretiert. 30Mit den Jahren hat jedoch der Rückgriff auf die Weimarer Erfahrungen an Bedeutung verloren. Im Zusammenhang mit den Katalogen über die Gesetzgebungsmaterien in den Art. 73 und 74 GG betont das Bundesverfassungsgericht allerdings nach wie vor die historische Auslegung mit der Begründung, dass in diesem Bereich die Begriffe an das historisch gewachsene Verständnis anknüpfen. 31
Читать дальше