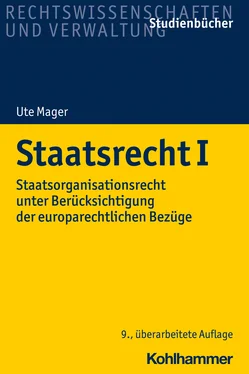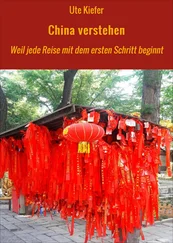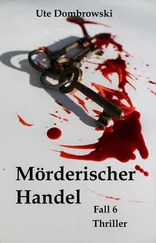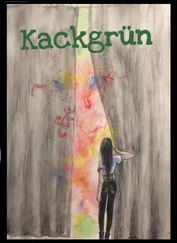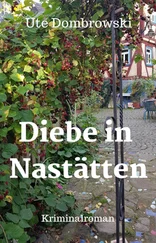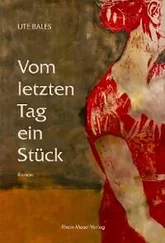Literatur: U. Battis/N. Eder , Der Krebsgang der Föderalismusreform, NVwZ 2019, 592; U. Häde , Zur Föderalismusreform in Deutschland, JZ 2006, 930; I. Härtel , Föderalismusreform II – Bund-Länder-Finanzbeziehungen im Lichte aktueller Ordnungsanforderungen, JZ 2008, 437; Ch. Hillgruber , Der Nationalstaat in der überstaatlichen Verflechtung, HStR II, 3. Aufl. 2004, § 32 Rn. 75–112; H. Hofmann , Föderalismusreformen im Verfassungsstaat, DÖV 2008, 833; F. Shirvani , Die europäische Subsidiaritätsklage und ihre Umsetzung ins deutsche Recht, JZ 2010, 753; U. Steiner , 70 Jahre Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Jura 2019, 441; N. Ullrich , Staats- und Verfassungsjubiläen 2019 – Gelingen und Scheitern deutscher Aufbrüche, JA 2019, 328.
Zweiter Teil:Verfassungsänderung und Verfassungskern
Fall 1:Das Staatsoberhaupt der Republik
1. Lässt das Grundgesetz die Einführung einer Monarchie
a) im Bund zu?
b) in einem Bundesland zu?
2. Könnte das Grundgesetz mit verfassungsändernder Mehrheit dahin abgeändert werden,
a) dass der Bundespräsident vom Volk gewählt wird?
b) dass der Bundespräsident nicht mehr auf fünf Jahre, sondern auf Lebenszeit gewählt wird?
1. Kapitel:Verfassungsänderung
62Die Verfassungenthält die grundlegenden Entscheidungen über die Rechtsverhältnisse in einem Gemeinwesen. 1Damit verbindet sich geradezu notwendig die Vorstellung der Dauerhaftigkeit. Die Verfassungsänderungsteht daher im Vergleich mit gewöhnlicher Gesetzgebung unter besonderen Bedingungen. Schon die Paulskirchenverfassung verlangte für Verfassungsänderungen ein erhöhtes Quorum „in beiden Häusern“ 2sowie die Zustimmung des Reichsoberhaupts (§ 196). Nach Art. 76 WRV war eine Verfassungsänderung im Wege des Gesetzgebungsverfahrens möglich, bedurfte aber einer 2/3-Mehrheit von mindestens 2/3 der gesetzlichen Mitgliederzahl des Reichstags. Die Weimarer Erfahrungen lehrten dann allerdings, dass ein besonderes Quorum als einziges Erfordernis für eine Verfassungsänderung die Verbindlichkeit und den beurkundenden Charakter des Verfassungstexts nicht wahren können. Die zwar als „unsittlich“ kritisierte, aber doch überwiegend nicht für verfassungswidrig befundene Praxis der stillschweigenden Verfassungsänderung und der Verfassungsdurchbrechung 3machte es möglich, dass die nationalsozialistische Machtergreifung sich in den Mantel formaler Legalität hüllen konnte.
Art. 79 GG ist Reaktion auf diese Erfahrungen. Er enthält formelle Voraussetzungenund – erstmalig in der deutschen Verfassungsgeschichte – auch materielle Grenzenfür Verfassungsänderungen. Anknüpfen konnten die Verfassungseltern dabei an Vorarbeiten aus der Weimarer Staatsrechtslehre, in deren Methodenstreit 4zwischen Rechtspositivismus 5und geisteswissenschaftlicher Richtung 6die Frage der Verbindlichkeit der Verfassung eine wichtige Rolle spielte. 7
1.1Art. 79 Abs. 1 und 2 GG
63Nach Art. 79 Abs. 1 Satz 1 GG finden Verfassungsänderungen im Verfahren der Gesetzgebung statt. Erforderlich ist eine Mehrheitvon 2/3 der gesetzlichen Mitgliederzahl des Bundestages (Art. 79 Abs. 2 iVm. Art. 121 GG). Auch der Bundesrat muss mit 2/3 seiner Stimmen eine Verfassungsänderung befürworten (Art. 79 Abs. 2 iVm. Art. 51 Abs. 2 und 3 GG).
64Zur Abwehr von Verfassungsdurchbrechungen und stillschweigenden Verfassungsänderungen statuiert Art. 79 Abs. 1 Satz 1 GG ein Textänderungsgebot. Verfassungsänderungen erfordern somit Niederschlag im Text der Verfassungsurkunde. Verfassungsänderungen, die Folge der Übertragung von Hoheitsrechten auf der Grundlage von Art. 24 Abs. 1 GG sowie solche, die Folge der europäischen Integration sind (Art. 23 GG), unterliegen diesem Textänderungsgebot allerdings grundsätzlich nicht. 8Dies ergibt sich für die Übertragung von Hoheitsrechten im Rahmen der europäischen Integration inzwischen ausdrücklich aus Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG. 9
Der komplizierte Satz 2 von Art. 79 Abs. 1 GG wurde im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um die Wiederbewaffnung und dem geplanten Beitritt zur Europäischen Verteidungsgemeinschaft 10als Grundlage für Art. 142a GG aF. in das Grundgesetz eingefügt. 11Da die Europäische Verteidigungsgemeinschaft nicht zustandekam, wurde Art. 142a GG im Zusammenhang mit der Einführung der Notstandsverfassung 1968 wieder beseitigt. Seither wurde von Art. 79 Abs. 1 Satz 2 GG kein Gebrauch mehr gemacht. Er ist heute ohne praktische Bedeutung. 12
1.2Art. 79 Abs. 3 GG: Die „Ewigkeitsgarantie“
65Art. 79 Abs. 3 GG zieht die inhaltlichen Grenzen für jegliche Verfassungsänderung. Unzulässig sind danach Änderungen des Grundgesetzes, welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Art. 1 und 20 GG niedergelegten Grundsätze berühren. Diese Vorschrift wird – missverständlich – als Ewigkeitsgarantie 13bezeichnet. Der ewige Bestand des GG ist damit aber weder tatsächlich garantiert noch auch nur gesollt. Revolutionäre Abschaffungdes Grundgesetzes lässt sich normativ nicht verhindern, friedliche Verfassungsneuschaffungwill das Grundgesetz nicht ausschließen, wie Art. 146 GG belegt. 14Die Funktion der Regelung besteht vielmehr darin, die Abschaffung der Verfassung unter dem Deckmantel der Verfassungsänderung unmöglich zu machen. Eine Verfassung ohne die in Art. 79 Abs. 3 GG genannten föderalen Elemente wäre – bei aller Rechtsstaatlichkeit und Demokratie – nicht mehr das Grundgesetz. Auch eine Verfassung ohne Menschenwürdegarantie und Grundrechtsbindung aller staatlichen Gewalten (Art. 1 GG) oder unter Aufgabe auch nur eines der in Art. 20 GG genannten Staatsstrukturprinzipien wäre eine andere Verfassung und nicht nur eine Modifikation der bestehenden. Art. 79 Abs. 3 GG garantiertdamit einen Verfassungskernund einen inhaltlichen Maßstab, an dem selbst noch verfassungsändernde Gesetze vom Bundesverfassungsgericht auf ihre Verfassungs(kern)gemäßheit überprüft werden können. Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG verdeutlicht zudem, dass der in Art. 79 Abs. 3 GG verankerte Verfassungskern im Sinne der Bewahrung der Verfassungsidentität 15auch der europäischen Integration Grenzen zieht. Eine unbegrenzte Kompetenzverlagerung auf die EU ist dadurch ausgeschlossen. 16
66Für die Auslegung des Art. 79 Abs. 3 GG ist seine Funktion, Verfassungsaushöhlungund Verfassungsabschaffungzu verhindern, besonders wichtig. Daraus ergibt sich zunächst notwendig, dass Art. 79 Abs. 3 GG selbst einer Abschaffung oder Änderung nicht zugänglich ist. 17Im Lichte der Funktion erschließt sich auch, was mit dem „Berühren“ der in Art. 1 und 20 GG niedergelegten Grundsätze gemeint ist, denn die Auslegung dieses Begriffs entscheidet über die schwierige Balance zwischen notwendiger Flexibilität und unantastbarem Verfassungskern.
Das Bundesverfassungsgericht hat im Abhörurteil die Frage, ob der Ausschluss des verfassungsrechtlich garantierten Rechtswegs in Bezug auf Abhörmaßnahmen (Art. 10 Abs. 2 und Art. 19 Abs. 4 Satz 3 GG) das Rechtsstaatsprinzip berühre und deshalb gegen Art. 79 Abs. 3 GG verstoße, aus den folgenden Gründen verneint: 18Der Sinn der Vorschrift bestehe darin „zu verhindern, dass die geltende Verfassungsordnung in ihrer Substanz (…) auf dem formal-legalistischen Weg eines verfassungsändernden Gesetzes beseitigt und zur nachträglichen Legalisierung eines totalitären Regimes missbraucht werden kann“. Die Grundsätze seien nicht berührt, wenn sie für eine Sonderlage aus evident sachgerechten Gründen modifiziertwürden. 19
Читать дальше