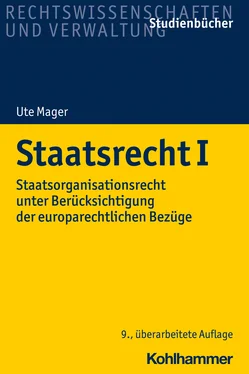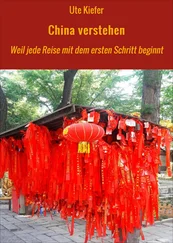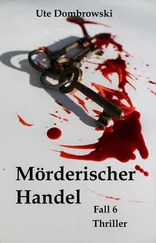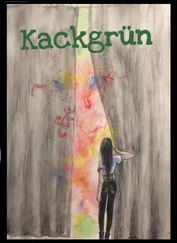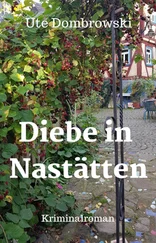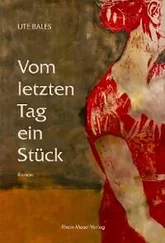71Der Sinn und Nutzen von Plebiszitenauf Bundesebene ist eine politikwissenschaftliche Frage. 8Verfassungsrechtlich ist streitig, ob plebiszitäre Elemente zusätzlich zu den wenigen im Grundgesetz genannten Fällen durch schlichtes Bundesgesetz eingeführt werden können. Systematisch spricht dagegen, dass die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes abschließend geregelt sind und für deren Inanspruchnahme allein das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren zur Verfügung steht. 9Eine Delegationsermächtigung an das Volk besteht nicht, anders etwa als zugunsten der Exekutive in Art. 80 GG. Das Argument, eine „Rück“-Delegation an den Souverän sei stets und voraussetzungslos möglich, überzeugt nicht, weil damit die abschließende Verbindlichkeit des Verfassungstextes und infolgedessen die Rechtsstaatlichkeit im Kern getroffen würde. 10Die systematische Interpretation bestätigt also, was auch der Entstehungsgeschichte zu entnehmen ist, nämlich, dass die Verfassungseltern auf Bundesebene keine Elemente plebiszitärer Demokratie aufnehmen wollten. 11Auch wenn die Plebiszite während der Weimarer Republik weder ihrer Art noch ihrer Zahl nach 12als Grundlage für „schlechte Erfahrungen“ ausreichen, mag doch die in anderer Weise vielfach erlebte Manipulierbarkeit der Massen während des Nationalsozialismus die Ablehnung motiviert haben. Der Begriff der Abstimmung in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG ist dennoch von Bedeutung, nicht nur für die wenigen Spezialregelungen im Grundgesetz, sondern vielmehr als Grundlage für die zahlreichen plebiszitären Bestimmungen in den Landesverfassungen 13, die demgemäß nicht außerhalb der von Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG geforderten strukturellen Homogenität zwischen Bundes- und Landesverfassungen liegen. 14
72Die Rechtsstaatlichkeit, die nach westlichem Demokratieverständnis notwendiger Bestandteil echter, nämlich freiheitlicher Demokratie ist, findet sich in Art. 20 GG nicht ausdrücklich als Prinzip genannt. Allerdings sind die wesentlichen Elemente einer rechtsstaatlichen Herrschaft garantiert, namentlich die Ausübung der Staatsgewalt durch verschiedene Organein der Wahrnehmung verschiedener Funktionen (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 GG), sowie die Bindung der Gesetzgebung an die Verfassung und der Exekutive und Judikative an Gesetz und Recht15 (Art. 20 Abs. 3 GG). Das Grundgesetz folgt in seinem Aufbau diesen rechtsstaatlichen Unterscheidungen, indem es in den Abschnitten III. bis VI. mit den Titeln Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident und Bundesregierung die obersten Staatsorgane behandelt, daran anschließend in den Abschnitten VII. bis IX. die Staatsfunktionen mit den Titeln „Die Gesetzgebung des Bundes“, „Die Ausführung der Bundesgesetze und die Bundesverwaltung“ sowie „Die Rechtsprechung“. 16Bereits dieser Gliederung ist zu entnehmen, dass das Grundgesetz keine einfache Gewaltentrennung vorsieht. Vielmehr ergeben sich aus den Vorschriften vielfältige Gewaltenverschränkungen in Form des Zusammenwirkens, der gegenseitigen Kontrollen und Hemmungen. Am stärksten ist der Gleichklang von Organ und Funktion bei der Rechtsprechung verwirklicht, die ihrem Wesen nach eine rechtsstaatliche Funktion ist und insbesondere die Aufgabe wahrnimmt, aus eigener Gesetzesbindung heraus die Gesetzesbindung der Exekutive zu kontrollieren. Als Ausprägung der Rechtsstaatlichkeit lassen sich auch der Grundrechtsabschnittund der Staatshaftungsanspruchnach Art. 34 GG begreifen.
73Das Sozialstaatsprinzip folgt dem Demokratieprinzip historisch nach. Es reagiert auf die Einsicht, dass gleiche Freiheit als Recht bei ungleichen tatsächlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten der Inanspruchnahme erhebliche tatsächliche Ungleichheit zur Folge haben kann, die nicht nur als ungerecht empfunden wird, sondern die Stabilität eines Gemeinwesens untergraben kann; eine Einsicht, die sich nicht zuletzt mit der Ausweitung des Wahlrechts auf alle Bevölkerungsschichten durchsetzte. Das Grundgesetz enthält allerdings nur wenige Ausprägungen des Sozialstaatsprinzips. Die Verfassungseltern verzichteten bewusst darauf, sozialstaatliche Versprechen in den Grundrechtsteil aufzunehmen 17, weil diese stets unter dem Vorbehalt der Präzisierung durch den Gesetzgeberund des finanziell Möglichen stehen und ihr Wille darauf gerichtet war, die Grundrechte als strikt verbindliche Rechtssätze zu formulieren. 18Ausprägungen der Sozialstaatlichkeit finden sich daher vor allem als Gesetzgebungsbefugnisse in den Katalogen der dem Bund zugänglichen Gesetzgebungsmaterien; zu nennen sind etwa die Kriegsopferfürsorge (Art. 73 Abs. 1 Nr. 13 GG), die öffentliche Fürsorge (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG), die Sozialversicherung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG), Ausbildungsbeihilfen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 13 GG), Wohngeldrecht und Altschuldenhilferecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG).
74Die Bundesstaatlichkeit durchzieht das Grundgesetz wie ein roter Faden. Die Staatsstrukturprinzipien des Art. 20 GG finden in Bezug auf die verfassungsmäßige Ordnung der Länder ihre Wiederholung in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG, der als Homogenitätsklauseleinerseits die Staatlichkeit der Länder 19voraussetzt und anerkennt, andererseits die notwendige Kompatibilität mit der Bundesverfassung sichert. Art. 30 GG formuliert den Grundsatz der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, wonach die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben Sache der Länder ist, soweit das GG nichts anderes bestimmt. Dieser Grundsatz wird in Bezug auf die Gesetzgebung in Art. 70 GG und in Bezug auf die Verwaltung in Art. 83 GG wiederholt. Steuergesetzgebung und Finanzverwaltung einschließlich der Steuererhebung haben ihre eigenen Kompetenzregelungen in Art. 104a ff. GG. Art. 31 GG statuiert mit dem lapidaren Satz „Bundesrecht bricht Landesrecht“ den Vorrang des Bundesrechtsund die Rechtsfolge der Nichtigkeit des Landesrechts im Falle der Kollision. 20Art. 32 GG regelt die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in Bezug auf die auswärtigen Beziehungen. 21Art. 35 GG verpflichtet Bund und Länder zu gegenseitiger Amtshilfe. Art. 36 GG sorgt für die föderale Zusammensetzung der Bundesbehörden und Art. 37 GG berechtigt den Bund, als äußerstes Mittel – das noch nie zur Anwendung gekommen ist – Länder mit Zwangsmitteln zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten ( Bundeszwang). 22
Der Bundesrat(Art. 50–53 GG) ist das föderale Organ auf der Bundesebene, das insbesondere bei der Bundesgesetzgebung mitwirkt, wie Art. 79 Abs. 3 GG es verlangt, aber auch an der Wahrnehmung einer Vielzahl anderer Bundesaufgaben beteiligt ist.
Die Funktionen der Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung sind in zum Teil komplizierten Abgrenzungen auf Bund und Länder verteilt. Derartige Regelungen machen jeweils einen wesentlichen Teil der Abschnitte über die Staatsfunktionen aus.
Literatur: A. Kees , Die Staatsstrukturprinzipien in der Klausurbearbeitung, JA 2008, 795; K. Engelken , „In Wahlen und Abstimmungen“ – Zur Bedeutung und Herkunft dieser Worte in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG –, DÖV 2013, 301; W. Henke , Zum Verfassungsprinzip der Republik, JZ 1981, 249; H.-P. Hufschlag , Einfügung plebiszitärer Komponenten in das Grundgesetz, 1999; J. Isensee , Republik – Sinnpotential eines Begriffs, JZ 1981, 1; W. Luthardt , Direkte Demokratie. Ein Vergleich in Westeuropa, 1995; S. Müller-Franken , Unmittelbare Demokratie und Direktiven der Verfassung, DÖV 2005, 489; M. Paus/A. Schmidt , Das Grundgesetz und die direkte Demokratie auf staatlicher und kommunaler Ebene, JA 2012, 48; J. Rux , Direkte Demokratie in Deutschland, 2008; U. Schröder , Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, JA 2017, 809; A. Voßkuhle , Rechtsstaat und Demokratie, NJW 2018, 3154; A. Voßkuhle/A.-K. Kaufhold , Grundwissen Öffentliches Recht: Das Rechtsstaatsprinzip, JuS 2010, 116; A. Voßkuhle/T. Wischmeyer , Grundwissen Öffentliches Recht: Das Sozialstaatsprinzip, JuS 2015, 693.
Читать дальше