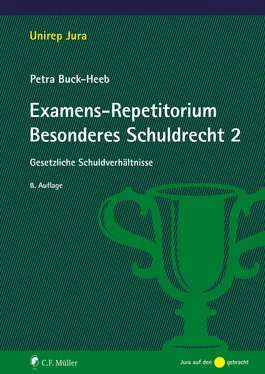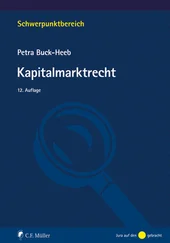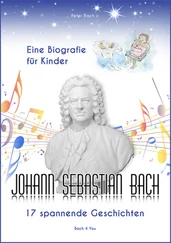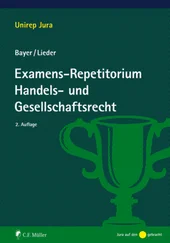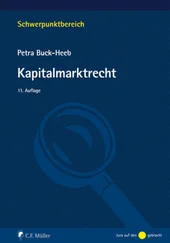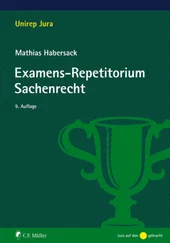II. II. Prüfungsreihenfolge 3 Die drei Hauptarten der gesetzlichen Schuldverhältnisse im Schuldrecht sind die Geschäftsführung ohne Auftrag, die unerlaubten Handlungen (samt der Gefährdungshaftung[2]) sowie das Bereicherungsrecht[3]. Die Reihenfolge der Nennung entspricht der Reihenfolge der Prüfung in einer Klausur , sofern alle drei Arten der gesetzlichen Schuldverhältnisse eine Rolle spielen. 4 Damit ergibt sich als zweckmäßiger Aufbau in der Klausur, dass, nachdem das Bestehen eines Vertrags – und damit eines vertraglichen Schuldverhältnisses – geprüft wurde, zunächst die Geschäftsführung ohne Auftrag zu prüfen ist. Da die Frage der Besitzberechtigung (siehe § 986) davon abhängt, ob zwischen den Beteiligten ein Vertrag besteht oder eine – einem Vertrag überwiegend gleichstehende – berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag, sind Vertrag und Geschäftsführung ohne Auftrag noch vor den §§ 985 ff., 2018 ff. zu prüfen. 5 Vor den Deliktsansprüchen wegen Eigentumsverletzung nach § 823 Abs. 1 sollten jedoch die dinglichen Ansprüche mit ihren Folgenansprüchen (v.a. §§ 985 ff. und 2018 ff.) geprüft werden. Denn diese Prüfung entscheidet darüber, ob Deliktsrecht überhaupt angewendet werden kann (vgl. § 993 Abs. 1, 2. HS). Am Ende stehen Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung, denn das Vorliegen eines Vertrags oder einer (berechtigten) Geschäftsführung ohne Auftrag ist ein Rechtsgrund i.S. des § 812. Dingliche Ansprüche gehen dem § 812 deshalb vor, weil auch Bereicherungsansprüche durch die §§ 985 ff., 2018 ff. ausgeschlossen sein können. Klausurtipp: Folgende Prüfungsreihenfolge sollte eingehalten werden: Vertrag, Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA), dingliche Ansprüche, deliktsrechtliche Ansprüche, Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung[4].
Prüfungsreihenfolge II. Prüfungsreihenfolge 3 Die drei Hauptarten der gesetzlichen Schuldverhältnisse im Schuldrecht sind die Geschäftsführung ohne Auftrag, die unerlaubten Handlungen (samt der Gefährdungshaftung[2]) sowie das Bereicherungsrecht[3]. Die Reihenfolge der Nennung entspricht der Reihenfolge der Prüfung in einer Klausur , sofern alle drei Arten der gesetzlichen Schuldverhältnisse eine Rolle spielen. 4 Damit ergibt sich als zweckmäßiger Aufbau in der Klausur, dass, nachdem das Bestehen eines Vertrags – und damit eines vertraglichen Schuldverhältnisses – geprüft wurde, zunächst die Geschäftsführung ohne Auftrag zu prüfen ist. Da die Frage der Besitzberechtigung (siehe § 986) davon abhängt, ob zwischen den Beteiligten ein Vertrag besteht oder eine – einem Vertrag überwiegend gleichstehende – berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag, sind Vertrag und Geschäftsführung ohne Auftrag noch vor den §§ 985 ff., 2018 ff. zu prüfen. 5 Vor den Deliktsansprüchen wegen Eigentumsverletzung nach § 823 Abs. 1 sollten jedoch die dinglichen Ansprüche mit ihren Folgenansprüchen (v.a. §§ 985 ff. und 2018 ff.) geprüft werden. Denn diese Prüfung entscheidet darüber, ob Deliktsrecht überhaupt angewendet werden kann (vgl. § 993 Abs. 1, 2. HS). Am Ende stehen Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung, denn das Vorliegen eines Vertrags oder einer (berechtigten) Geschäftsführung ohne Auftrag ist ein Rechtsgrund i.S. des § 812. Dingliche Ansprüche gehen dem § 812 deshalb vor, weil auch Bereicherungsansprüche durch die §§ 985 ff., 2018 ff. ausgeschlossen sein können. Klausurtipp: Folgende Prüfungsreihenfolge sollte eingehalten werden: Vertrag, Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA), dingliche Ansprüche, deliktsrechtliche Ansprüche, Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung[4].
3 – 5 II. Prüfungsreihenfolge 3 Die drei Hauptarten der gesetzlichen Schuldverhältnisse im Schuldrecht sind die Geschäftsführung ohne Auftrag, die unerlaubten Handlungen (samt der Gefährdungshaftung[2]) sowie das Bereicherungsrecht[3]. Die Reihenfolge der Nennung entspricht der Reihenfolge der Prüfung in einer Klausur , sofern alle drei Arten der gesetzlichen Schuldverhältnisse eine Rolle spielen. 4 Damit ergibt sich als zweckmäßiger Aufbau in der Klausur, dass, nachdem das Bestehen eines Vertrags – und damit eines vertraglichen Schuldverhältnisses – geprüft wurde, zunächst die Geschäftsführung ohne Auftrag zu prüfen ist. Da die Frage der Besitzberechtigung (siehe § 986) davon abhängt, ob zwischen den Beteiligten ein Vertrag besteht oder eine – einem Vertrag überwiegend gleichstehende – berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag, sind Vertrag und Geschäftsführung ohne Auftrag noch vor den §§ 985 ff., 2018 ff. zu prüfen. 5 Vor den Deliktsansprüchen wegen Eigentumsverletzung nach § 823 Abs. 1 sollten jedoch die dinglichen Ansprüche mit ihren Folgenansprüchen (v.a. §§ 985 ff. und 2018 ff.) geprüft werden. Denn diese Prüfung entscheidet darüber, ob Deliktsrecht überhaupt angewendet werden kann (vgl. § 993 Abs. 1, 2. HS). Am Ende stehen Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung, denn das Vorliegen eines Vertrags oder einer (berechtigten) Geschäftsführung ohne Auftrag ist ein Rechtsgrund i.S. des § 812. Dingliche Ansprüche gehen dem § 812 deshalb vor, weil auch Bereicherungsansprüche durch die §§ 985 ff., 2018 ff. ausgeschlossen sein können. Klausurtipp: Folgende Prüfungsreihenfolge sollte eingehalten werden: Vertrag, Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA), dingliche Ansprüche, deliktsrechtliche Ansprüche, Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung[4].
§ 2
Zusammentreffen verschiedener Ansprüche
I. Unterschiede zwischen gesetzlichen und vertraglichen Schuldverhältnissen 6 – 12
II. Wechselwirkungen zwischen den Ansprüchen 13 – 20
Zweiter Teil Geschäftsführung ohne Auftrag
§ 3 Überblick
§ 4 Anwendbarkeit der GoA
I. Konkurrenzen 27, 28
II. Wertungswidersprüche 29 – 36
1. Unbestellte Leistung (§ 241a) 30
2. Selbstaufopferung im Straßenverkehr 31, 32
3. Gefälligkeit 33, 34
4. Nichtigkeit eines Vertrags 35
5. Nichtzustandekommen eines Vertrags 36
§ 5 Die berechtigte GoA
I. Geschäftsführer tätigt ausschließlich fremdes Geschäft 39 – 59
1. Fremdes Geschäft 40 – 43
2. Fremdgeschäftsführungswille 44 – 46
3. Ohne Auftrag 47, 48
4. Interesse und Wille des Geschäftsherrn 49 – 59
a) Interesse 49
b) Wille 50 – 52
c) Differenz zwischen Interesse und Wille 53, 54
d) Unbeachtlichkeit des entgegenstehenden Willens 55 – 58
e) Berechtigtheit der GoA 59
II. Geschäftsführer tätigt eigenes, aber auch-fremdes Geschäft 60 – 79
1. Grundlagen 60 – 63
2. Privatrechtliche Handlungspflichten 64 – 66
3. Öffentlich-rechtliche Handlungspflichten 67 – 73
4. Innenausgleich zwischen Gesamtschuldnern 74 – 79
III. Geschäftsfähigkeit der Beteiligten 80 – 83
IV. Rechtsfolgen der berechtigten GoA 84 – 102
1. Ansprüche Geschäftsführer gegen Geschäftsherrn 85 – 92
2. Ansprüche Geschäftsherr gegen Geschäftsführer 93 – 102
§ 6 Die unberechtigte GoA
I. Voraussetzungen 104, 105
II. Ansprüche Geschäftsführer gegen Geschäftsherrn 106, 107
III. Ansprüche Geschäftsherr gegen Geschäftsführer 108 – 112
§ 7 Die unechte GoA
I. Irrtümliche Eigengeschäftsführung, § 687 Abs. 1 113
II. Angemaßte Eigengeschäftsführung, § 687 Abs. 2 114 – 120
Dritter Teil Deliktsrecht
§ 8 Grundlagen
I. Systematik des Deliktsrechts 121 – 125
II. Anwendbarkeit der §§ 823 ff. 126 – 128
III. Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche 129 – 133
IV. Verjährung 134 – 138
V. Entgeltfortzahlung und Versicherungen 139 – 141
§ 9 Der deliktische Haupttatbestand: § 823 Abs. 1
I. Rechts- oder Rechtsgutverletzung 143 – 253
Читать дальше