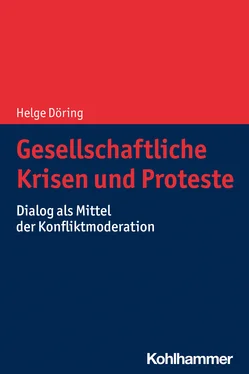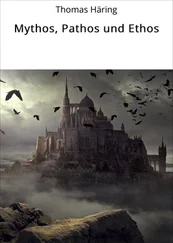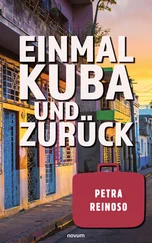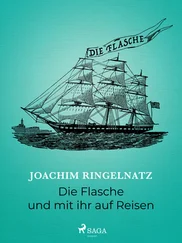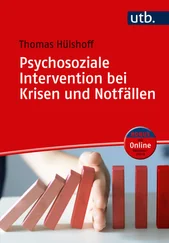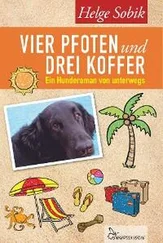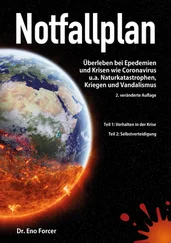Zuletzt gilt mein Dank Aladin El-Mafaalani, der mich mit dem Projekt KDZ betraute, zahlreiche inhaltliche Anregungen und Ideen zum Projekt beisteuerte und das Geleitwort dieses Buches verfasste.
Helge Döring (Dortmund, Oktober 2021)
Stellen wir uns vor, die Gesellschaft wäre ein großer Raum mit einem Tisch in der Mitte und einem großen Kuchen. Zunächst sitzen nur wenige Menschen am Tisch, die meisten sitzen in der zweiten und dritten Reihe, viele sogar auf dem Boden. So lässt sich die Gesellschaft bis Ende des 20. Jahrhundert beschreiben. Aber etwa ab der Jahrtausendwende hat eine enorme Dynamik eingesetzt: Immer mehr und immer unterschiedlichere Menschen sitzen am Tisch, mittlerweile auch Frauen, LSBTIQ*, Schwarze, Muslime, Menschen mit internationaler Geschichte, Menschen mit Behinderung und Ostdeutsche. Die Tischgesellschaft ist auch deutlich jünger als noch vor einigen Jahrzehnten. All diese Menschen wollen einen schönen Platz am Tisch und ein Stück vom Kuchen. Sie wollen sich aber auch in die Regeln zu Tisch und das Rezept des Kuchens einmischen – sie wollen mitbestellen und mitentscheiden.
Dass es ausgerechnet jetzt, wenn so viele Menschen wie noch nie teilhaben können und wollen, gemütlich und harmonisch wird, erscheint völlig absurd – wenn man die Situation tatsächlich analytisch betrachtet. Intuitiv gehen die allermeisten Menschen davon aus, dass Integration und Teilhabe zu Harmonie und Konsens führen. Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass das Konfliktpotenzial steigt, dass vieles in einem intensiven und kontroversen Prozess neu ausgehandelt werden muss und dass es zu einem beschleunigten Wandel kommt. Genau diese analytisch logischen, aber kontraintuitiven Zusammenhänge habe ich als Integrationsparadox auf den Begriff gebracht, wobei ich lediglich die Erkenntnisse der Klassiker der Soziologie wieder in Erinnerung gerufen und auf die Situation der aktuellen Migrationsgesellschaft übertragen habe.
Von Karl Marx bis Max Weber lässt sich rekonstruieren, dass die »alten« Soziologen in Konflikten das Potenzial für Entwicklung und Innovation erkannten. Georg Simmel gilt als Begründer der Konfliktsoziologie und erhob als erster vor über einem Jahrhundert den Begriff »Streit« zu einem Grundlagenbegriff der Soziologie, was bedeutet: Ohne den Streit zwischen Individuen und zwischen Kollektiven zu verstehen, lässt sich weder die Gesellschaft verstehen, noch soziologische Theorie entwickeln. Wie lässt sich erklären, dass wir die positiven und konstruktiven Positionen gegenüber Konflikten verloren haben? Nun, nach zwei Weltkriegen und Völkermorden hat sich die Perspektive gedreht: Man sah nun in Ordnung und Harmonie den »guten« Normalfall, Wandel und Konflikte wurden nur deshalb zu Forschungsfragen, weil sie als Problem wahrgenommen wurden. Vor dem Hintergrund der größten Gewaltexzesse durchaus nachvollziehbar. Lewis Coser und Ralf Dahrendorf verdanken wir eine Wiederbelebung und Etablierung der Konflikttheorie und der Konfliktforschung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die für die Analysen der gegenwärtigen Krisenerscheinungen und Konfliktpotenziale von unschätzbarem Wert sind.
Konflikte können etwas Wunderbares sein, sich als Treibstoff für gesellschaftlichen Entwicklung manifestieren, allerdings nur dann, wenn man die ihnen zugrundeliegenden Entwicklungen erkennt und die entstandene Energie konstruktiv nutzt. Es ist davon auszugehen, dass das gleiche Konfliktpotenzial zu Fortschritt oder zu Gewaltexzessen führen kann. Das ist die Ambivalenz des Konflikts. In jedem Fall ist sicher, dass ganz ohne Konflikte Entwicklung und soziale Innovationen kaum denkbar sind. Ohne die konstruktive Austragung von Konflikten hätten sich Menschenrechte, Sozialstaat und Demokratie nicht durchsetzen können. Diese ungemütlichen und anstrengenden Prozesse sind von höchster Relevanz, das intuitiv Falsche kann analytisch betrachtet richtig sein. Deshalb muss sich gerade die Wissenschaft (wieder) viel stärker mit dem Potenzial von Konflikten und Krisen beschäftigen.
In dem vorliegenden Buch geschieht genau das. Vorgestellt werden die Ergebnisse des Projektes »Krisen-Dialog-Zukunft«. Die im Rahmen der Förderlinie »Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten von Krisen und Umbrüchen« vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Studie wurde im Zeitraum von 2018 bis 2021 an meinem Arbeitsbereich an der Fachhochschule Münster (nach meinem Wechsel vertreten durch Sebastian Kurtenbach) federführend von Helge Döring durchgeführt. In dieser vielschichtigen Studie werden Möglichkeit aufgezeigt, in jenen ergebnisoffenen konstruktiven Streit zu treten, der den Kern liberaler Demokratien und offener Gesellschaften ausmacht. Von Relevanz sind die Erkenntnisse und Befunde insbesondere für zivilgesellschaftliche Akteur*innen und kommunalpolitische Entscheidungsträger*innen, aber auch für die wissenschaftliche Diskurse über die Bedeutung von Konflikten in der offenen Gesellschaft, über Entwicklung von sozialen Konflikten, ihre Auflösung etc.
Die vorgelegte empirische Analyse ist voller gehaltvoller Reflexionen aus ganz unterschiedlichen Krisen- und Konfliktkonstellationen. Die Fallstudien umfassen Debatten um den Klimawandel, die Zuwanderungs- und Integrationspolitik und das Leben in urbanen Konflikträumen (z. B. die Dortmunder Nordstadt). In einem Exkurs gibt der Autor ebenfalls einen Einblick, wie Konflikte über Social Media geführt werden und sich dort phasenweise immer weiter verschärfen. Helge Döring geht es um methodische Möglichkeiten der Prävention und Entwicklung von Resilienz gegenüber Eskalationen von lokalen Konflikten und Desintegrationsprozessen vor Ort. Auf welche Weisen konnten bei lokalen Transformationsprozessen Krisen bewältigt werden? Wie können friedliche Zustände gewahrt, Konflikte ausgetragen und Veränderung ermöglicht werden? Wie lässt sich Offenheit als zentraler Bezugspunkt einer konstruktiven Streitkultur gegen Populist*innen und Extremist*innen verteidigen und wo müssen Grenzen des Dialogs gezogen werden?
Diese politisch höchstrelevanten Fragestellungen werden von Helge Döring in dieser qualitativen komparativen Forschung bearbeitet. Mittels (teil-)standardisierter Expert*inneninterviews und teilnehmender Beobachtung wurde umfangreiches Datenmaterial erhoben, um vor allem »worst cases« als Anschauungsmaterial für Praktiker*innen aufzubereiten. Diese Fälle werden vertiefend analysiert und miteinander verglichen. Dabei wird deutlich, in welchen Zeitintervallen Dialogformate gewinnbringend eingesetzt werden können, um Krisen präventiv abzuwenden, abzuschwächen oder in Kompromisslösungen zu überführen.
Das Buch ist Amtstäger*innen, Multiplikator*innen und aktiven Bürger*innen zu empfehlen, die sich darin schulen möchten, den pluralistischen und liberalen Grundkonsens unserer Gesellschaft auch in Zeiten von beschleunigtem Wandel, Konflikten und Umbrüchen konstruktiv zu gestalten. Streitkultur und Krisenfestigkeit gehören zu einer lebendigen Demokratie dazu.
Aladin El-Mafaalani (Osnabrück, Juni 2021)
Protest ist Alltag, ob auf Marktplätzen oder Smartphones. Selten verstetigt er sich, sondern findet in der Regel eine Übersetzung in Kompromisse, was ein Zeichen einer vitalen und funktionierenden Demokratie ist. Einer solchen Konsensfindung liegen teils komplizierte, langwierige und zugleich symbolträchtige Dialogrunden zugrunde, ohne die eine Einigung unmöglich wäre. In diesem Buch geht es nicht um das Ergebnis einer Verständigung, sondern darum, wie diese zustande kommt. Das ist umso wichtiger, da die Protestwellen scheinbar zunehmend über das Land rollen. Während in den Jahren 2015 und 2016 vor allem PEGIDA mit seinem völkisch-nationalistischen Protest gesellschaftspolitische Debatten bestimmte, war es im Jahr 2019 ein klimaorientierter Protest eines tendenziell sozialliberalen Milieus mit politisch sehr heterogener Ausprägung. Dieser versammelte sich vor allem unter dem Banner von »Fridays for Future« und wurde von Schüler*innen und Studierenden vorangetrieben. 2020 wiederum war geprägt von Protesten gegen die Maßnahmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie, welche teils rechtsextreme, verschwörungsmystische und demokratiedistante Einflüsse aufweisen. Protest gewinnt damit, zulasten von direkter Partizipation, an Bedeutung zur Willensdurchsetzung im demokratischen System. Es geht demnach Zusehens nicht mehr darum, selbst politische Verantwortung zu übernehmen, sondern politisch Verantwortliche zu beeinflussen. Diese Veränderung mag zunächst wie eine postdemokratische Entwicklung wirken, doch kann sie auch als Ausdruck eines Wandels der politischen Kultur verstanden werden, einer Kultur, in der Dialog eine zunehmende Bedeutung zukommt.
Читать дальше