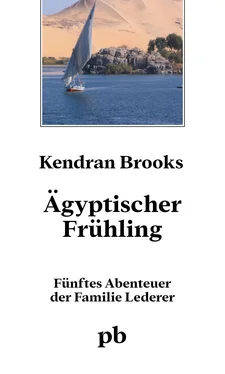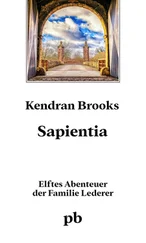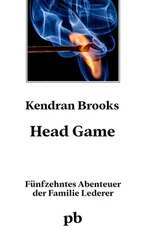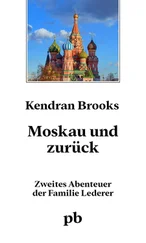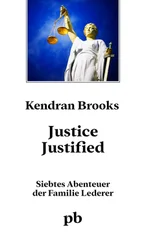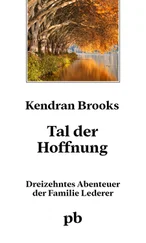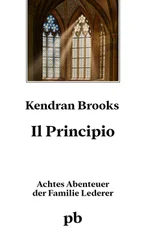All dies hatten sie schon so oft im Streit erörtert. Dabei konnte er seine Tochter so gut verstehen, ihre Ideale, ihre Hoffnungen. Doch das Leben verlief anders, war nicht fair, gerecht oder gar logisch. Das Leben bestand aus der Balance zwischen Macht und Machtmissbrauch auf der einen Seite, dem Kämpfen und Fügen auf der anderen. Welches System unter welchem Diktator herrschte, spielte dabei kaum eine Rolle.
Selbstverständlich konnte sich Walid noch gut an sein eigenes Leben im Westen erinnern, auch wenn diese unbeschwerte Zeit in London bereits drei Jahrzehnte zurück lag. Walid gehörte damals zu den wenigen Ägyptern, die ein ganzes Jahr lang an der angesehenen St. George’s University Medizin studieren durfte. Er erhielt ein Stipendium, das genauso wie heute mit dem Studienplatz verbunden war. Während seinen Monaten im Westen legte er die Regeln des Islam weitgehend ab, tauschte sie ein gegen das egoistisch geprägte Leben der Europäer, fühlte sich frei und ohne jede Verantwortung für sich selbst und auch andere. Zweimal schwängerte er damals Studentinnen. Doch beide Frauen - Allah sei’s gedankt – trieben ohne Murren ab. Sie hatten selbst nicht mehr als eine kurzlebige Begierde auf den überaus hübschen, schwarz gelockten, dunkelhäutigen, jungen und hochaufgeschossenen Muslime verspürt, hatten sich auf das Abenteuer mit seiner fremden Haut, ohne nachzudenken oder gar zu planen eingelassen. Heute empfand Walid seine Schuld an den Ungeborenen weit tiefer als damals, als junger, unbedarfter Mann.
Walid kehrte aus seinen Gedanken zurück zu Malika. Sie war die jüngste seiner vier Töchter und ihm die liebste, auch wenn die anderen drei ihm mit den Enkelkindern viel Freude bereiteten.
Walid spürte einen Grimm in seinem Inneren aufflackern, einen Zorn auf die Umstände, aber auch auf seine Tochter und auf die heute so kompliziert gewordene Welt. Er fühlte sich schwach und ohne Möglichkeiten, Einfluss auf all das zu nehmen. Vielleicht fielen seine Worte darum härter als gewollt aus.
»Du musst damit aufhören, hast du mich verstanden, Tochter?«
»Mit dem Kampf gegen die Ungerechtigkeit?«, begehrte Malika sofort auf und warf ihren Kopf in den Nacken, »niemals!«
Walid schüttelte kurz und unwirsch seinen Kopf, blickte seine Tochter mit wilden Augen an: »Nein, deine nächtlichen Streifzüge, deinen Umgang mit fremden Männern. Du verlierst noch deine Ehre, wenn dir nicht noch Schlimmeres zustößt.«
Sie blickte erst ohne Verständnis und ein wenig mitleidig, dann aber mit neu erwachtem Trotz, Stolz und Mut zu ihm hoch und in seine Augen hinein, versuchten sie an die ihren zu fesseln: »Papa, ich habe keine Angst vor den verdammten Schergen des verfluchten Greises Mubarak. Selbst im schlimmsten Fall. Dreck kann man immer wieder abwaschen.«
»Oh, stolze Tochter, bete zu Allah, dass er dich nicht prüfen möge. Du weißt doch gar nicht, wovon du sprichst. Doch mit deinem Verhalten bringst du nicht nur Schande über dich, sondern auch über deine gesamte Familie, deine Brüder und Schwestern und deine Eltern.«
Malika starrte wieder auf ihr Teeglas, rührte mit dem Löffel um den getunkten Pfefferminz-Stängel herum, dachte dabei an Adilah, ihre Schulfreundin aus früheren Tagen, die sie gestern erst nach langer Zeit wieder einmal getroffen hatte. Malika erschauderte innerlich, fasste sich jedoch rasch wieder.
»Doch, Papa, ich weiß, was passieren kann. Du kennst doch auch Adilah Iswabad aus der al-Falki? Ihr Vater besitzt den kleinen Gemüseladen«, und als ihr Vater kurz und düster nickte, fuhr seine Tochter fort, »sie wurde letzten November vom Geheimdienst verhaftet und verschleppt. Erst nach drei Wochen kam sie wieder frei, war während dieser Zeit mit Schlägen misshandelt, mit Elektroschocks gefoltert und mehrere Male vergewaltigt worden. Das Kind hat sie sofort abtreiben lassen und ein geschickter Chirurg hat ihre Jungfräulichkeit hergestellt. Doch trotz all dem schrecklichen Erlebten steht sie weiterhin Abend für Abend auf dem Platz draußen, nimmt an jeder Demonstration teil, schreit ihren Zorn gegen das Regime umso lauter in die Welt hinaus.«
Walid sagte nichts darauf, dachte nicht an das Schicksal der armen Adilah, fühlte nur seine eigene Hilflosigkeit, wusste, dass ihm die Worte fehlten, um seine jüngste Tochter zu Vernunft zu bringen. Er wandte sich schweigend ab, blickte wieder aus dem Fenster und hinunter auf den Tahrir-Platz, sah zwei junge Männer aus einem der Zelte herauskrabbeln, sich gähnend recken und aufstehen. Sie wechselten ein paar Worte miteinander, dann entfernte sich der eine der beiden, ging quer über den Platz und auf den Burger King an der Ecke zu, wollte wohl Frühstück oder zumindest Kaffee und Tee besorgen. Der andere sah ihm ein paar Sekunden lang nach, drehte sich dann ab und verschwand wieder im Zelt.
»Du machst also weiter?«, fragte er, ohne den Kopf vom Fenster weg zu drehen.
»Ja, Papa.«
Und nach einer kurzen Pause fügte Malika leise hinzu: »Bis zum endgültigen Sieg.«
*
»Du sagst, er hat sich verändert?«
Chufu saß auf einem der breiten Ledersessel, seiner Adoptivmutter Alabima gegenüber. Sie hatte auf dem Sofa Platz genommen und nickte bekümmert.
»In der Nacht wache ich manchmal auf, weil Jules im Schlaf redet. Seine Träume scheinen sich immer und immer wieder um dieselben Themen zu drehen, um die Tötung dieser jungen Frau in Mogadischu, um irgendwelche CIA Schergen und um seine große Angst, die er um uns ausstehen musste. Und dann seine plötzliche Sammelwut auf Waffen. Hast du schon einen Blick in den Tresorraum im Keller geworfen? Da stapeln sie sich bereits. Zudem geht er nur noch selten aus dem Haus und er lässt Alina und mich kaum mehr aus den Augen, überwacht uns regelrecht.«
»Seine Besorgnis um euch ist doch verständlich, Alabima, nach all den erlebten Schrecken. Ebenso seine Albträume. Und die Waffen? Nun, vielleicht erlangt er mit ihrer Hilfe seine frühere Sicherheit zurück?«
»Aber das ist noch nicht alles, Chufu. Er kapselt sich immer mehr ab, trifft keine Freunde mehr, lädt auch niemanden mehr zu uns ein. Ich glaube, er sieht überall nur noch Gefahren oder mögliche Feinde. Ich denke, Jules leidet an Verfolgungswahn.«
Aus Alabimas Stimme klang leichte Verzweiflung. In den letzten zwölf Monaten war Chufu nur für zwei kurze Besuche von seinem Studium an der Universidade Federal do Rio de Janeiro in die Schweiz zurückgekehrt, hatte darum viel von der Entwicklung seines Adoptivvaters Jules verpasst. Diesmal wollte er zumindest für zwei Wochen bleiben, denn seine Freundin Mei Ling besuchte ihrerseits mit der Familie zusammen über das Neujahrsfest hinaus ihre Verwandten in China.
»Aber am Telefon hat er stets ganz normal auf mich gewirkt«, versuchte er das von Alabima beschriebene Problem klein zu reden.
»Ja, er ist ein guter Schauspieler«, gab Alabima zurück, »wenigstens über eine kurze Dauer hinweg. Doch egal, um wen oder was es sich auch handeln mag. Nach wenigen Minuten wird Jules unruhig und seine Gedanken schweifen ab, verlieren sich im nirgendwo. Probiere das ruhig mal aus in den nächsten paar Tagen und mach die selbst ein Bild über seinen Zustand.«
Ihre Unterhaltung wurde unterbrochen, denn Jules kam die Kellertreppe hoch, zog die Türe hörbar hinter sich in ihr Schloss, trat wenig später ins Wohnzimmer, wirkte aufgeräumt, ja geradezu in Hochstimmung.
»Und, was unternehmen wir heute Nachmittag«, meinte er gut gelaunt und blickte seinen Adoptivsohn auffordernd an, »wollen wir gemeinsam Lausanne unsicher machen?«
Chufus bewusst gewolltes, unbekümmertes Lachen misslang. Die Worte von Alabima hatten ihre Wirkung auf ihn nicht verfehlt. Die offensichtliche Freude von Jules empfand auch er nun als eine gespielte Maske. Als Student der Psychologie begann er bereits, seinen Adoptivvater zu analysieren und zu katalogisieren.
Читать дальше