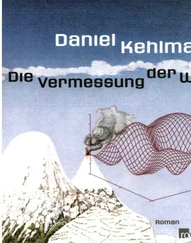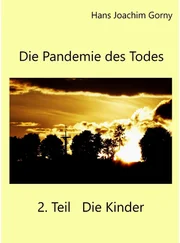„Und dann kam Mira von hinten herein, mit einem Beil in der Hand. Der Kapitän fragte sie: Welche? Sie antwortete: Die Zweitletzten. Er nickte. Mira hatte, stellte sich heraus, die zweitletzten Kisten geopfert und die Halterungen mit dem Beil gekappt, so dass sie abstürzten. Damit hatte sie irgendwelchen wilden Nomaden Material für den Hausbau geschenkt. Auf die Fahrzeuge in den letzten Kisten wollte Mira am Ankunftsort dann doch nicht verzichten. Es kam in dieser Nacht noch zu einer dritten, zum Glück leichteren Schieflage, die hatte Mira durch Ablassen unseres Wassers bereinigt. Bei so einem Sturm wäre landen ja Selbstmord, der würde den Wal auf den Boden dreschen. Ich sage euch, das war die längste Nacht meines Lebens.“
Die drei Paare lagen noch lange wach, achteten auf jedes Geräusch und warteten darauf, dass der Wind den Wal schüttelt. Doch der brummte leise und gleichmäßig dahin. Robbe hatte in zweitausendsiebenhundert Metern Höhe eine Windströmung nach Westen gefunden, die dem Gefährt nahezu einhundert Stundenkilometer erlaubte. Anoos letzter Gedanke vor dem Einschlafen war: Hoffentlich hat Tairiri recht.
Zwei Tage später war das Wetter immer noch ruhig. In der Ferne konnte die Besatzung das höchste Gebirge der Welt erkennen, das Himala-Gebirge, das sich rechts ihrer Route befand und sich tausende Kilometer von Ost nach West dahin zog. Von morgens bis abends standen die Leute bei klarem Wetter an den Scheiben, starrten zu der weiß gleisenden Gebirgskette hinüber und schafften es nicht, sich satt zu sehen. Der Kapitän musste sie ständig ermahnen nicht alle auf der rechten Seite herumzuhängen, der Wal ließe sich schlechter steuern, schimpfte er. Die meisten der Crew kannten die beeindruckenden schnee- und gletscherbedeckten Berge der Südinsel. Diese konnten dem Himala bestenfalls als Vorgebirge dienen. Es war das Gebirge, in dem in einer Höhle die berühmten Mini-mini-Filme gefunden wurden. Der Wal flog sehr tief, nur noch hundert Meter hoch. Aber nicht weil er Gas verlor, sondern weil Robbe und Mira nach einem Landeplatz suchten, das Wasser war knapp. Mira, mit Fernglas in der Hand, zeigte nach rechts in ein Tal auf eine freie Fläche, Robbe lenkte in das Tal und ließ Gas ab. Tal war immer gut, in einem Tal war es windstiller als auf einer Ebene.
Der Wal senkte sich bis knapp über die Kieslandschaft, zwei Männer ließen sich an Seilen herab und trieben Pflöcke in den Kies, zehn Stück, an denen sie den Wal vertäuten. Von der Unterseite zweier Kisten wurden lange Schläuche entrollt, die Enden in das Bachbett gelegt, die Pumpen begannen ihre Arbeit. Gleichzeitig begann Robbe oben Gas zu produzieren. Die Forscher nahmen Wasserproben und verteilten sich dann in der Landschaft, um bei dieser Gelegenheit Tiere, Pflanzen und Steine zu untersuchen.
Bei schönem Wetter nutzten die Wal-Besatzung solche Zwischenaufenthalte, um draußen auf der Erde zu übernachten. Ebro suchte für sie auf einer Sandbank eine Lagerstätte aus, die vier Arbeiter verteilten sich am Ufer und suchten trockenes Schwemmholz für zwei Lagerfeuer. Das Versorgungsdreigespann hatte dadurch viel mehr Arbeit und weitere Wege. Landis beschwerte sich bei Mira Feensal. „Wieso muss ich diese Arbeit machen? Ich bin schließlich Biologin.“
„Wir sind alle irgendwas“, konterte die Chefin. „Aber die Jüngsten fangen nun mal in der Küche an.“
„Und sie?“ Landis zeigte in Richtung der niedlichen Schönen, die unmöglich älter als sie sein konnte.
„Ria ist der einzige Freiland-Zoologe den wir dabei haben und wird viel unterwegs sein.“ Mira beorderte den Arbeiter mit dem vorlauten Mundwerk zur Versorgungsgruppe. „Aber schön vertragen“, schärfte sie den Beiden ein.
Der Arbeiter grinste. „Ich möchte doch nicht ausgestopft werden.“ Da musste auch Landis lachen.
Nach dem Abendessen, das zur Abwechslung erhitzt wurde, sammelten sich die Reisenden um die zwei Lagerfeuer. Mira und Robbe schliefen im Wal. Um das eine Feuer saßen und lagen die drei Pärchen, zu denen sich Darran und zwei Frauen gesellten. Die eine Frau war die Zoologin Ria. Die Gespräche plätscherten so dahin, bis Potati sich bei Ria nach wilden Tieren erkundigte.
Ria antwortete mit einer leisen aber klaren Stimme. „Natürlich gibt es hier wilde Tiere. Um die auf Abstand zu halten, müssen die Feuer die Nacht hindurch brennen.“
„Was wären denn die Gefährlichsten, die heute Nacht um uns herumschleichen?“ wollte Ebro wissen.
Ria zögerte. „Hm, wir sind in Indien. Da gibt es Tiger, Löwen und Hyänen. Die Katzen haben keine Angst vor uns, die gehen in der Nacht davon aus, dass wir sie nicht sehen können. Aber ich kann euch beruhigen, wir passen nicht in ihr Beuteschema, die fressen höchstens unsere Abfälle.“ Ria hatte ihr Wissen aus alten Büchern und konnte sich nicht sicher sein, dass das Beuteschema einer vergangenen menschenreichen Zeit auch für die Gegenwart seine Gültigkeit besaß. Sie selbst hatte keine Angst und wollte einfach nur beruhigen. Darran Tui erhob sich und ging zum Wal.
„Was wären denn die größten Tiere, die hier zu erwarten sind?“ fragte Landis.
Ria überlegte. „Ich schätze mal Elefanten, Nashörner, einige Büffel- und Hirscharten. Die Dickhäuter sind hier fast so groß wie in Afrika.“ Ein Schweigen stellte sich ein. Jeder wusste, was es mit Afrika auf sich hatte. „Schade, dass wir nicht über Afrika fahren konnten“, erzählte die Zoologin weiter. „Da gibt es riesige Tierherden. Soweit das Auge reicht nur Antilopen und Zebras. Millionen davon. Herden aus Elefanten, Nashörnern, Giraffen und mächtigen Büffeln. Und überall lauern die Beutemacher. Ich würde mir das sehr gerne ansehen. Aber leider kann man nicht auf diesen Kontinent.“
Kuro, Anoos Mitarbeiter, räusperte sich. „Man kann da schon hin. Nur kommen die Wenigsten zurück.“
„Es weiß vermutlich kein Mensch, wie viele Abenteurer dort schon ums Leben gekommen sind“, flüsterte Ria betrübt.
„Mein Vater fuhr früher zur See“, redete Kuro weiter. „Sein Kapitän wollte einen Elefanten und ein Nashorn fangen und mindestens tot am Stück nach Hause bringen. Sie landeten an der ostafrikanischen Küste in einer stillen Bucht und das erste was sie fanden, war ein versenktes Schiff. Das Schiff, das nur von unseren Inseln sein konnte, war wohl den Wilden in die Hände gefallen.“
„Und damit wohl auch die Crew“, stellte Ria fest. „Und wie ist es deinem Vater ergangen?“
„Mein Vater und zwei andere blieben mit Schießgeräten an Bord, der Kapitän zog mit zehn Mann los, um die Wildnis zu erforschen. Am Abend waren sie zurück. Für den nächsten Tag ließ er ein Lastenfahrzeug an Land bringen, mit dem sie noch tiefer in die Wildnis eindrangen. Die drei die in der Fahrerkabine saßen, haben es überlebt. Von denen die auf der Ladefläche saßen, kamen vier zurück. Doch die hatten kleine und große Pfeilspitzen in Armen und Beinen stecken. Diese waren vergiftet. Alle Vier sind in der Nacht gestorben. Da waren die Überlebenden zum Glück schon auf hoher See. Die Wilden hätten sich bestimmt in der Nacht an Bord geschlichen.“
„Sind die echt so mordgierig dort?“ erkundigte sich Raputa.
„Diese Schwarzen sind wie Furien“, erklärte Ria.
„Ach, die sind schwarz?“ reagierte Potati überrascht. „So richtig mit schwarzer Haut von oben bis unten?“
Ria nickte. „Die erkennt man im Dunkeln nur wenn sie lachen. Wenn sie sich an Fremde anschleichen, lachen sie aber nicht. Mit den Schwarzen kann man nicht verhandeln, man kann mit ihnen keine Freundschaft schließen, sie lassen sich nicht einmal beschenken. Wenn sie Menschen mit heller Haut sehen, rasten sie aus und wollen die sofort töten, als ob auf der Welt keine hellhäutigen Menschen existieren dürften. Die kennen nur das Bestreben, jeden von uns zu liquidieren. Da muss eine Urangst dahinter stecken, dass alles Hellhäutige Unglück bringt. Es gab unzählige Versuche mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Jeder dachte, er kann es besser als seine Vorgänger, aber keine Expedition kam ohne Verluste zurück. Wie viele Expeditionen, die sich aus Habgier in das Landesinnere gewagt haben, nicht zurückgekommen sind, weiß keiner.“
Читать дальше