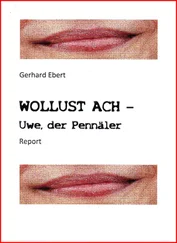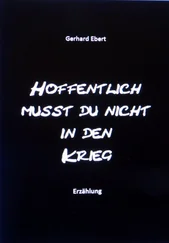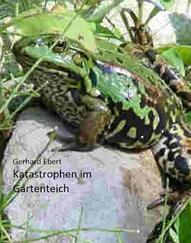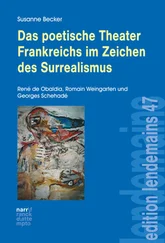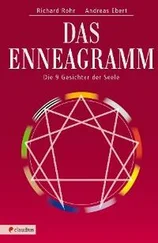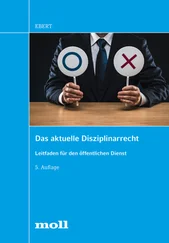In der Regie von Wolfgang Fleischmann wird die epische Abfolge, Grusches Flucht, dramatisch dicht, ebenso die Stationen des durch die Lande ziehenden Azdak. Die Gesänge (Hans-Dieter Schlegel, Christa Bergerec, Janina Brankatschk und Peter Thomsen) wirken nicht retardierend, vielmehr voranführend, auch dadurch, daß die Haltungen der Sänger wechseln, koordiniert mit den Begebenheiten auf der Bühne. Und dort wird ohne Maske agiert, was dem ursprünglichen Spiel dienlich ist, das sich in dem poesievoll-sachlichen Bühnenbild Jan Hempels gut entfalten kann.
Hans-Dieter Schlegel — der kraftvolle, stattliche Sänger Arkadi Tscheidse — kommt anfangs der schlagfertige Witz des Azdak etwas schwer von der Zunge. Und wenn er sich reumütig selbst der neuen Obrigkeit stellt, wird sein Motiv nicht recht plausibel. Doch dann, unvermutet zum Richter gemacht, gewinnt dieser Azdak Profil. Seine Errettung vom Galgen wird zur groß gespielten Wiedergeburt, nach der er gereifter, wissender richtet, um Gerechtigkeit ringend. Und der Grusche rät er zu guter Letzt leise und kameradschaftlich, das Weite zu suchen.
Alles in allem arbeitet ein homogenes und jung wirkendes Ensemble. Zahlreiche Darsteller waren notgedrungen doppelt besetzt, aber das fiel nur anhand des Personenzettels auf. Majka Kowarjec gibt deutlich die blasierte Klassenbeschränktheit der Natella Abaschwili, Achim Wenk einen ungestümen fetten Fürsten Kazbeki. Marja Ulbrichec gefällt als Hofmeisterin Nina und als die Alte, Hannelore Torka als Makinä Abakidse und Mütterchen Grusinien, Jurij Kostorz als Panzerreiter, Wirt und Anwalt Schuboladze. Blaß bleibt der Simon von Jan Mahr.
Mit dieser Inszenierung wurde das neue Haus des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen würdig eröffnet, und es scheint, als seien die Bautzener im Begriff, ihr Theater für sich zu erobern. Die Bauarbeiter zumindest, skeptisch zunächst, als es um Brecht ging, waren schließlich ein sehr dankbares Publikum. Und noch dies: Vor rund zwei Jahrzehnten war Senftenberg unter Horst Schönemann zum Inbegriff zielstrebiger Ensemblearbeit und junger, realistischer Schauspielkunst geworden. Vielleicht ist es voreilig, mich dünkt, in Bautzen bestehen günstige Voraussetzungen für eine ähnliche Entwicklung.
Bleibt resümierend festzuhalten, daß letztlich die weitere praktische Begegnung mit dem Werk Bertolt Brechts erweisen muß, ob eher ein artifiziell demonstratives oder ein mimetisch konkretes ursprüngliches Spiel heutiger Kommunikation mit dem Dichter entspricht. Die vordergründige Didaktik des „Zeigetheaters" jedoch ist unwiderruflich und ganz einfach konventionell.
Theater der Zeit, 9/1975
von Johannes R. Becher,
Nationaltheater Weimar,
Regie Gotthard Müller
Bechers trotzige Sehnsucht
Die Aufführung beeindruckt durch die Konsequenz, mit der die Fabel von der Dramaturgie (Sigrid Busch und Grit Goldberg) herauspräpariert und von der Regie (Gotthard Müller a.G.) in Szene gesetzt wurde. Das vom Dichter wahrhaftig nicht vordergründig auf Abläufe gearbeitete Werk wird zu zügigem und mühelos nachvollziehbarem Geschehen verdichtet, durch Musik (Konrad Aust) emotionsbetont unterstützt. Die gekürzten Meditationen wirken nicht retardierend und sind — über Lautsprecher eingesprochen — entpathetisiert. Die komplizierten Wege des Johannes Hörder und des Gerhard Nohl werden unmittelbar sinnfällig.
Aber transportiert die pralle Gegenwärtigkeit der Fabel wirklich genug von der reichen poetischen Substanz dieses klassischen Werkes des sozialistischen Realismus? Zu Johannes R. Becher gehören Wohllaut der Sprache und eigenwilliges Pathos. Neben bewegten sozialen Beziehungen der Figuren, deren Aktionen dramatisch aus epischer Abfolge herausbrechen, stehen pathetische Meditationen der Figuren, stehen dialogisierte Welt- und Selbstbetrachtungen, nur bedingt fabeldienlich, auch nicht gestisch, aber doch eben geschrieben, weil der Dichter Auffassungen von Menschen spiegelt, weil er einen Querschnitt zu geben trachtet über Misere und Hoffnung deutschen Denkens in der Nacht des Faschismus.
Da ist noch Wesentlicheres, latent dem Werk innewohnend: Die ins Poetische gehobene politische Haltung des Dichters, seine feste, sieghafte Gewißheit in die Zukunft des deutschen Volkes. Tiefe Wehmut, Bestürzung und Trauer, gewiß, aber auch Glücksgefühl und der ungebrochene Stolz des parteilichen und patriotischen deutschen Dichters auf seine deutsche Nation selbst in ihrer erbärmlichsten Stunde. Sollten solche Haltungen heute und hier nicht empfindbar werden, sollten wir ihnen nicht ästhetischen Reiz verleihen, hier, in unserem Lande, wo sich Bechers trotzige Sehnsucht in Gestalt der sozialistischen deutschen Nation realisiert?
Theater, wie wir es heute verstehen und pflegen, sucht diese poetischen Impulse über die Fabel und über das soziale Verhalten der Figuren zu vermitteln. Das ist eine, Bertolt Brecht zu dankende, schwer erkämpfte Errungenschaft, die wir behaupten müssen. Aber wir sollten zugleich immer wieder sondieren, was solche Spielweise objektiv und effektiv zu leisten vermag. Für Becher ist sie ganz einfach zu schmal, von zu geringer Bandbreite. Zudem verlieren ästhetische Errungenschaften an Lebens- und Wirkungskraft, wenn nicht — von ihnen ausgehend — ständig versucht wird, neue Dimensionen zu erschließen. Bechers Werk, dessen poetische Virtualität vor allem, wäre schöpferische Aufgabe und Möglichkeit in eben diesem Sinne. Der Weimarer Inszenierung ist zu danken, auf diese, wie mich dünkt, Entwicklungsproblematik unserer Schauspielkunst aufmerksam gemacht zu haben, dadurch, daß sie aus Bechers perspektivischer Tragödie der deutschen Nation das Handeln der Figuren prosaisch-direkt und mit prägendem Stilwillen ins Spiel brachte.
Agiert wird in einem praktikablen, einfach und geschmackvoll von Bernhard Schröter a. G. raumvielfältig eingerichteten Bühnenbild. In gedämpftem Licht erheben sich drei Hügel, Spielflächen, die sich bei Szenenwechsel schnell in Panzer oder Gefechtsunterstände verwandeln lassen. Die Begebenheiten in der deutschen Stadt spielen links und rechts im Vordergrund. Und der Regisseur arrangiert das Geschehen folgerichtig in diese Spielräume. Mit wenigen stürmischen Schritten kann Johannes Hörder aus der elterlichen Wohnung hinaus aufs Schlachtfeld gelangen, was zugleich seine erbarmungswürdige Verlorenheit signalisiert. Die Flucht aus der elterlichen Hölle wird zur Flucht in die Hölle faschistischen Mordbrennens. Übergänge von Szene zu Szene sind dergestalt nicht formale Abläufe, sie werden fabeldienlich gehandhabt, mit ihnen werden inhaltliche Prozesse schaubar gemacht.
Ins Blickfeld rückt das Tun und Lassen der beiden jungen faschistischen Soldaten Johannes Hörder und Gerhard Nohl, und dies insbesondere für die zahlreichen jungen Zuschauer, die den Faschismus und den 2.Weltkrieg nur aus dem Geschichtsbuch kennen. Unaufdringlich wird eine noble didaktische Absicht spürbar. Der Konflikt des jungen Hörder ist nachvollziehbar, dessen Verstricktsein in ein Schicksal, aus dem auszubrechen ihm nicht mehr gelingt. Humanistische Verantwortung auch unter faschistischem Regime wird postuliert.
Detlef Heintze als Johannes Hörder sucht die Widersprüche der Figur. Aufrecht und stramm, eine treue deutsche Seele, tritt er ans Mikrophon des Reporters, schwer wird ihm die Zunge, wenn er begreift, daß er Unwahrheiten kolportieren soll. Bemerkenswert, wie Heintze die zunehmende Vereinsamung, das Ausgeliefertsein des Johannes mit jugendlicher Unbekümmertheit bricht, so die Figur immer wieder identifizierendem Interesse empfehlend. Wenig überzeugt hat mich sein »Ich kann nicht anders« am Grab der gefangenen Partisanen. Das Historische dieses Vorganges, das Aufbegehren eines jungen Deutschen gegen den Faschismus, die Geburtsstunde eines deutschen Antifaschisten, bleibt verborgen, wird nicht durch sozial konkretes, den Vorgang genau erfassendes gestisch-mimisches Spiel transparent.
Читать дальше