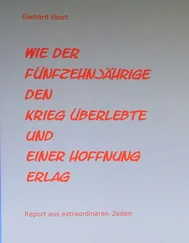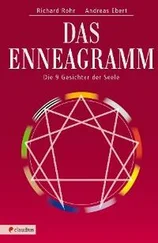Gewichtiger als der Gewinn eines vagen Zusammenhanges beider Stücke ist der Gewinn an Perspektive für unsere Schauspielkunst. Ganz offensichtlich ist die notwendigerweise ausgiebige Auseinandersetzung mit Kleist, das behutsame Hervorholen hinter vielschichtiger Patina, das differenzierte historische Einordnen, das Bekenntnis zum Tragikomiker, das Empfinden für seine romantische Phantasie, das Mühen um seine Sprache — ganz offensichtlich hat all dies unserer zuweilen überrationalisierten Schauspielkunst einen Hauch schöpferischer Ursprünglichkeit vermittelt, der ihr gut ansteht.
Theater der Zeit, 8/1975
von Bertolt Brecht in Dessau, Regie Denys Seiler,
„Der Kreidekreis“
von Bertolt Brecht in Bautzen, Regie Wolfgang Fleischmann
Ursprünglicher Brecht
Unsere Besuche in Dessau und Bautzen halfen, klarer wahrzunehmen, was eine allgemeine Tendenz im Umgang mit Brecht zu sein scheint und nach unseren bisherigen Eindrücken zwar Empfindung, noch nicht aber Erkenntnis genannt werden konnte. Bekanntlich war das „Zeigetheater" schon zu Brechts Lebzeiten umstritten, das „Zeigen" der Figuren in der „richtigen distanzierten Haltung". Schauspieler wie Ernst Busch oder Gerhard Bienert haben immer bewiesen: der soziale Gestus — eine der großen Entdeckungen Brechts für die Schauspielkunst — läßt sich auch „spielen", er muß nicht unbedingt „gezeigt" werden. Der Streit ist abgeklungen, vielleicht auch, weil die Praktiker Jahr für Jahr zu Antworten herausgefordert, Entwicklungen ausgelöst haben, die ihn müßig machen.
Der heute zu beobachtende Trend — von Peter Kupke im Berliner Ensemble durch „Puntila" deutlich mit Akzenten versehen und erfreulicherweise nicht mehr allein von der Hauptstadt vorgegeben — geht auf ursprüngliches mimetisches Spiel, vermeidet distanzierte Haltung gegenüber den Figuren und sucht unmittelbare, sozusagen „klassische" Kommunikation mit dem Publikum. Die Inszenierungen in Dessau und Bautzen sprechen dafür, wenn auch mit auffällig unterschiedlichen Ergebnissen.
In der Dessauer Aufführung — ein wenig nüchtern ausgestattet von Günter Kretzschmar — gibt Gerhard Rachold den Puntila. Er versieht ihn mit derben, kräftigen Zügen, urwüchsig, vital, ihn nicht distanziert zeigend, sondern ursprünglich spielend. Aber sein Spiel ist wenig mimetisch, bezieht das Clowneske der Figur, das Element der Commedia dell'arte, ganz aus dem überkommenen Reservoir artifizieller Fertigkeiten, ist nicht konkrete Geste, auch nicht sozialer Gestus, sondern demonstrative Theatergebärde. Und Kretzschmar liefert dazu weite Beinkleider und betont großes Jackett. So wird Puntila zur plastischen Theatergestalt, ungelenk stehend oder einhergehend, ausladend in der Spielastik der Arme, mit weit aufgerissenen, rollenden oder baß erstaunten Glubschaugen. Damit erzielt Rachold überrachende Wirkungen, und das Publikum folgt seinem Spiel mit interessierter Aufmerksamkeit und offenkundigem Vergnügen. Hin und wieder scheint es, als sei sein Puntila soeben einer Zeichnung von George Grosz entstiegen, mit stilisierter, groß gezogener Körpersprache und drastischer, ausdrucksstarker Mimik. Unverdrossen verstrickt er sich in die Fährnisse seiner Trunkenheit, trollt er durch die Szenen. Das ist durchweg possierlich, aber der poetische Witz verliert an Stoßkraft. Vor allem deshalb: Rachold nimmt als nüchterner Puntila lediglich den Text etwas flotter, er hetzt mit ihm, als wolle Puntila recht schnell über die Nüchternheit hinwegkommen. Aber den Unterschied zwischen trunken und nüchtern nutzt er kaum für die Beredsamkeit seines Spiels, selbst das Nüchternwerden in der Badestube wird zu wenig zum beredten Vorgang. Hier steht die Theatergebärde im Wege, hier reicht sie nicht aus, bei Brecht schon gar nicht.
Wahrscheinlich hat auch der Regisseur die Fabelpunkte in Nüchtern- und Besoffenheit des Puntila zu wenig im Auge gehabt. Denys Seiler reizte z.B. der Gesindemarkt, das Verdingen der Knechte. Auf seinem Dorfplatz warten die Arbeitsuchenden zusammengepfercht in einem Holzverschlag, eingesperrt wie wohlfeiles Vieh. Die begutachtenden und auswählenden Großbauern laufen rauchend um das Gatter herum. Und neben diesem makabren Geschehen das emsige Treiben des normalen Marktlebens. Das auffällige Zeigen dieser sozialen Widersprüche ist möglich und legitim, gewiß, aber wichtiger für die Fabel ist Puntilas Aktion auf dem Gesindemarkt. An sich kommt die Auseinandersetzung zwischen Puntila und Matti gut ins Spiel, denn Hans-Dieter Krone gibt einen naturalistisch direkten Matti, bar fast jeder theatralischen Gebärde. Damit tut sich ein großer Gegensatz auf zwischen dem artifiziellen Puntila und dem alltäglichen Matti. Allein, dieser Gegensatz ist statisch, entwickelt sich kaum im Verlaufe des Spiels, und seine Lösung — ein guter Einfall: Matti verläßt Puntila geradeswegs vom Hatelmaberg — kommt ein wenig überraschend.
Selbstverständlich erfordert das große Dessauer Haus eine eigene Spielweise, und ganz ohne Zweifel ist das demonstrative Agieren Racholds gerade auch darauf bedacht. Aber es fällt auf, daß die distinguierte Verstörtheit, mit der Christine Lindemer gestisch konkret die Pröbstin spielt, durchaus auch das Publikum erreicht. Mehr oder weniger demonstrativ handeln die Bräute des Puntila (Verena Zimmermann als Emma, Jutta Spychalski als Apothekerfräulein, Dagmar Morgenthal als Kuhmädchen, Hannelore Kreutz als Telefonistin), überzogen hingegen wirkt Bärbel Röhl als Eva. Sie fand kein organisches Zentrum für solche Spielweise, sie rutscht oft ab in leeres Grimassieren und verschrobenes Gebaren. Einfach schlecht, wie sie mit langem Zigarettenspitzel bewaffnet posierend und hüfteschwenkend über die Bühne schiebt. Beredt der Vorgang jedoch, wenn sie in der Eheprobe erkennt, daß ihre Erziehung falsch war, und prompt dem Vater ihre Niederlage zuspielt. Etwas von der Gefährlichkeit des Puntila erzählt die Fina Susanne Roders, die wie ein aufgescheuchtes, verängstigtes Huhn rennt und hantiert, den nüchternen Puntila zu bedienen. Mit bornierter, selbstgefälliger Arroganz stattet Herbert-Wolfgang Krause den Attache aus.
In der Bautzener Aufführung gibt Hannelore Schubert die Grusche. Ihr Spiel ist mimetisch, gesund naiv, sozial konkret und bis in die Sprache hinein gestisch genau. Sie redet nicht, sondern produziert die Gedanken, gestisch verbalisiert. Und das ist eindrucksvoll, jede Phase interessiert, erzwingt Aufmerksamkeit. Der Ungeheuerlichkeit ihrer Tat bewußt, versteckt sie das hohe Kind. Wenn sie zurückkommt, lauscht sie zunächst vorsichtig, zögert sie, nimmt sie es behutsam auf, weil sie es einfach nicht allein lassen kann. Deutlich spielt sie die feine Dame, um dem Kind ein Obdach zu verschaffen, doch dann, fast am Ziel, vergißt sie sich, grüßt sie ehrerbietig. Stets bringt sie den beredten Vorgang, der über Grusches Verhältnis zur Welt und zu den Menschen erzählt. Fröhlich tollt sie, wirft sie ihr Bündel Habseligkeiten in die Lüfte, wenn sie sich der schweren Bürde entledigt, das Kind ausgesetzt hat. Doch dann werden die Schritte schwer, und als die Panzerreiter kommen, eilt sie, das Kind zu retten. Diese Grusche ist von bestrickender Einfachheit, eine wahre Volksgestalt, bar theatralischer Gebärden, die Geste vielmehr genau und klar aus der Situation entwickelnd, poetisch im Ausdruck, damit Anteilnahme- und Sympathie der Zuschauer gewinnend. Scheu steht sie zunächst hinter Simon, da es zum Prozeß kommt, am liebsten möchte sie sich ganz verbergen. Doch dann kann sie nicht mehr an sich halten, verlegen ringt sie die Hände, sucht sie nach Argumenten, bis sie schließlich den Richter zornig attackiert. Die kleine, etwas gedrungene, bescheidene und unscheinbare Darstellerin verfügt über Kraft und Sensitivität, und wenn sie als Grusche ihr Kind nicht aus dem Kreidekreis ziehen kann, weil sie es nicht zerreißen will, wird sie noch kleiner, noch unscheinbarer, zur gepeinigten, hilflosen Kreatur. Ihren endlichen Sieg empfinden wir als gerechten Triumph des Humanismus: die Kinder den Mütterlichen.
Читать дальше