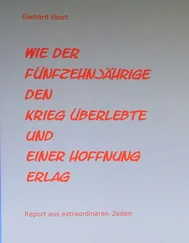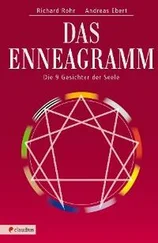Das Erscheinen Krjukows ist ohnehin eine der schwierigen künstlerischen Aufgaben, die das Stück stellt. Wenn versachlichend das gesellschaftliche Anliegen Tscheschkows inszeniert, die verbale Auseinandersetzung rationell gegeben, aber das ihr zugrundeliegende konkrete Handeln der Figuren wenig gestisch erschlossen wird, dann gerät diese aktuelle Chronik unversehens in die Nähe didaktischen Agit-Theaters. Und das Auftreten Krjukows braucht dann keine sozial und psychologisch begründeten Zusammenhänge, sondern lediglich ein obwaltendes übergeordnetes Prinzip. In Nordhausen wird eben dies sinnfällig. Dort sitzt der spätere Krjukow von Anbeginn auf dem Rang, liest zunächst die Zwischentexte von oben herab und greift dann sitzend und lesend ins Geschehen ein. Und die Figuren auf der Bühne heben andächtig die Köpfe, treten erwartungsvoll näher und lauschen nach oben. So kommt ein Vorgang in das Stück, der darin eigentlich nicht zu entdecken ist.
Regisseur K. F. Zimmermann benutzt ein Spielpodest auf der Bühne, das von Scheinwerfern umgeben ist. Diese karge, assoziationshemmende Ausstattung Carlheinz Städters mag mit dazu geführt haben, vor allem den hartnäckig kämpfenden Tscheschkow (Peter Dreessen) herauszuarbeiten. Seine Beziehungen zur Stschegoljowa (Gisela Maedel) erscheinen mehr als beiläufiges Fremdgehen, denn als ernsthafte Liebe. Dieser Tscheschkow geht völlig in seiner Arbeit auf, sein unermüdliches Ringen, seine Unbedingtheit und Strenge prägen sich ein. Die untheatralisch gehaltene, vom Wort lebende Inszenierung findet beim Anrechts-Publikum nur geringen Widerhall. Aber in Betrieben ist ihre Resonanz erheblich, erzielt sie Wirkung in ihrer sachlichen Kargheit, kann sie nachvollzogen werden. Und das ist ein Vorzug: das einfache Spielpodest läßt sich überall aufschlagen!
Auch Eisenach benutzt ein auf der Bühne installiertes Podest. Doch Gregor Pabst hängt ein originell gearbeitetes, schönes Relief von Leningrad und den Neresher Werken dahinter, poetische Absichten signalisierend. Und Regisseur Dieter Roth a.G. sucht eine Spielweise, die das vielfältige Beziehungsgeflecht der Figuren schaubar zu machen trachtet. Zur Einführung läßt er alle Figuren vom Spielleiter, dem späteren Krjukow, vorstellen, damit Vertrautheit der Zuschauer mit den Gestalten herstellend. Das komplizierte Geschehen kann wissender verfolgt werden. Nicht sachliche Kühle, nüchterner Report, sondern einfache Anschaulichkeit, diskrete Bildhaftigkeit kennzeichnen diese Inszenierung. Empfindlich stört der Einfall, Tscheschkow (Uwe Schmidt a. G.) am Ende selbstzufrieden und banal erklären zu lassen: „Nun läuft der Laden!" Die den Konflikt in gewissem Sinne harmonisch austragende Inszenierung scheint einen ebensolchen Schluß zu heischen. Gewiß muß jedes Ensemble an die Seh- und Erlebnisgewohnheiten seines Publikums anknüpfen, aber zum Profil, das diese Hauptfigur im Verlauf ihrer Auseinandersetzungen gewinnt, sollte man sich bis zum Schluß bekennen. Im Übrigen hat die Inszenierung viele schöne Details. Tscheschkow wahrt trotz aller aufzubietenden Härte und Energie eine nervlich gesunde Ausgewogenheit, kontert Schroffheit mit Umgänglichkeit. Seine Liebe zur Stschegoljowa (Renate Bahn) wird als ernst spürbar, bleibt aber relativ einschichtig.
Eine frappierende Lösung bietet Horst Ruprecht in Halle, auf den ersten Blick vielleicht konventionell anmutend, in Wirklichkeit Herkömmliches geschickt nutzend, ganz und gar darauf gerichtet, mittels theatralischer Faszination an möglichst viele Zuschauer heranzukommen. Der Tendenz der Berliner Fassung, das gesellschaftliche Anliegen Tscheschkows rationell nach vorn zu holen und seine privaten Konflikte — Ehefrau, Geliebte — zurückzudrängen, wird entgegengewirkt mit reicher Anschaulichkeit der Vorgänge, mit kluger dramaturgischer Pointierung des Beginns. Henning Schallers Ausstattung ermöglicht, den ganzen Bühnenraum ins Spiel zu bringen und assoziiert Weite und Größe der Neresher Werke wie auch des Gegenstands.
Tscheschkow (Klaus-Rudolf Weber) und Poluektow (Horst Lampe) betreten die Stahlwerke durch die Tür des eisernen Vorhangs, krachend schlägt sie zu. Der Vorhang hebt sich, gleißendes Licht blendet aus dem Hintergrund, lärmend fährt ein Podest aus der Drehbühne, wird herumgeschwenkt: die erhobene Residenz der „mächtigen Männer". Plushin thront mit dem Rücken zum Zuschauer, leitet zunächst recht anonym, muß sich dem Publikum en face stellen, wenn aus dessen Mitte heraus Krjukow eingreift. Viele überzeugende Einfalle, Einfalle vor allem, die Schauspielkunst stimulieren und szenisch beredt Geschehnisse zwischen Menschen erhellen. Da wird das Betriebsfest gefeiert, und aus dem scheinbar zwanglosen Hin und Her kristallisieren sich wesentliche Vorgänge heraus, entwickelt sich der Konflikt. Das spießige Hecheln über Tscheschkow geschieht, wird aber nicht zum vorherrschenden Eindruck, vielmehr das Zueinanderfinden des Heißsporns Tscheschkow und der feinnervigen Stschegoljowa (Marie-Anne Fliegel) in verhaltener, herber Liebe. Persönliche Interessen und Beziehungen weiten sich zu gesellschaftlichen und umgekehrt. Etwa, wenn Tscheschkow und Managarow sich um die Stschegoljowa bemühen, da ist Konkurrenz zwischen Männern, aber nicht Eifersucht, Managarow (Siegfried Voß) steht zu Tscheschkow. Die Regie betont einige Fabelpunkte geradezu verfremdend, aber legitim und überlegt. Laut bricht aus Tscheschkow heraus, dass er den Plan nicht erfüllen will. Die lange Pause nach dem Ausbruch gibt seiner Erklärung Gewicht, provoziert Nachdenken. Groß wird sodann die Peinlichkeit gezeigt, die die Eingesessenen befällt, als Tscheschkow von Fälschung spricht. Unüberhörbar ist schließlich, wie der zusammenbrechende, fast wirr eifernde Tscheschkow in der Dienstbesprechung für unbedingte Wahrheit und Ehrlichkeit in den Arbeitsbeziehungen plädiert. Das wird geradezu zur Botschaft, die der zermürbte Tscheschkow mit letzter Kraft ins Publikum schleudert. Wenn jetzt von dorther in Gestalt Krjukows die Partei eingreift, von der Woge der Sympathie für Tscheschkow ebenso getragen wie von der gedanklichen Übereinstimmung mit dessen Argumenten, wird das zum faszinierenden Höhepunkt der Aufführung.
Dworezkis Stück — das kann unumwunden resümiert werden — hilft unserer Theaterkunst, neue Wirklichkeiten zu entdecken, neue Wertvorstellungen zu prägen und in neuer Kommunikation zwischen Bühne und Zuschauerraum das Publikum geistig und gefühlsmäßig in das Ausfechten und Auskämpfen von Widersprüchen und Konflikten einzubeziehen. Dem Gegenstand angemessen und der Entwicklung unserer Theaterkunst dienlich sind dabei Kühnheit und Entdeckerdrang beim Ausprobieren faszinierender theatralischer Lösungen voller Bildhaftigkeit und Anschaulichkeit wie von reicher schauspielerischer und szenischer Beredsamkeit.
Theater der Zeit, 3/1975
von Bertolt Brecht,
Schauspielhaus Erfurt,
Regie Dieter Steinke
Belehrung
Theatralische Rezeption überkommener Dramatik muß sich dem Zeitgeist stellen. Sie wandelt sich unter den Impulsen und Intentionen des Tages und kann theoretisch schwerlich vorweggenommen werden. Praktisches Vermögen der Gegenwart vor allem gibt Fingerzeige, legt Tendenzen bloß. Als Bertolt Brecht in einem Brief an ein New Yorker Arbeitertheater feststellte: „Die unversiegliche gute Laune der listigen Wlassowa, geschöpft aus der Zuversicht ihrer jungen Klasse, erregte glückliches Lachen auf den Bänken der Arbeiter", gewann er diese Erkenntnis aus damals aktuellen Absichten und Lösungen. Verallgemeinernd schrieb er schließlich im „Kleinen Organon", Vergnügung sei die nobelste Funktion, die er für Theater gefunden habe. Wie steht es heute damit? Teilen wir diese Auffassung in unserer Begegnung mit Brecht? Wir suchten Antwort im Theateralltag, in Berlin wie in Anklam, Erfurt und Prenzlau.
Читать дальше