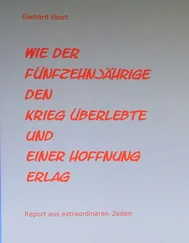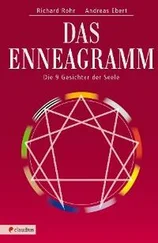Das heterogene Spiel entfaltet sich im praktikablen, die Kargheit griechischer Berge assoziierenden Bühnenbild Falk von Wangelins: Lysistrates Vaterhaus, Domizil der Frauen, ein Gasthof mit Sauna, Weinkelterei und allerhand Zimmern und traulichen Plätzchen. Kalonike vor allem, die Kellnerin, und Stavros, der Knecht, wissen's zu schätzen. Das klassische Dienerpaar greift bei Hochhuth nicht handlungsbestimmend ein. Perten jedoch läßt Stavros, betont durch eine Maske, sarkastische Sentenzen des Dichters über die Figuren sprechen, und rückt damit plebejische Positionen ins Zentrum. Rita Feldmeier gibt eine muntere, sinnenlustige Kalonike, Egon Brennecke einen rustikalen, schenkelflinken Stavros. Amüsant sein freundlich begehrender Satyrtanz um die stripteasende Kalonike. Hier wie bei chorischen Auftritten der Frauen oder der Männer beweist sich die stilsichere Hand des chilenischen Choreographen Patricio Bunster.
Die Titelfigur hat der Autor mit politisch rationaler Abgeklärtheit wohl bedacht, aber darüber die Frau vernachlässigt. Christine van Santen gibt die Frau, antike Erhabenheit mit emanzipierter Weiblichkeit verschmelzend. Bemerkenswert Erhard Schmidt als fülliger Tsifras, Bettina Mahr als gestisch konkrete liebesagile Ariadne, Karl-Heinz Fischer als eifernder Koumantaros. Plastizität ihrer Figuren erreichen auch Katrin Stephan (Popadia), Hannelore Seezen (Tina), Hermann Wagemann (Glarakis), Manfred Schlosser (Babalis) und Ulrich Voss (Dimitrios). Peter Zilles bleibt dem Popen die Doppelbödigkeit schuldig. Das Ensemble arbeitet engagiert und mit sichtlichem Vergnügen. Ein verdienter, schöner Erfolg.
Theater der Zeit, 3/1975
von Ignati M. Dworezki,
Theater in Halle, Nordhausen, Erfurt und Eisenach
Womit wollen wir unser Theater bewegen, wenn nicht mit einem solchen Stück? Wir fanden Theater in Halle, Nordhausen, Erfurt und Eisenach, die ihre Zuschauer unterhielten „mit der Weisheit, welche von der Lösung der Probleme kommt,... mit all dem, was die Produzierenden ergötzt", mit „Geschehnissen zwischen Menschen" (Brecht). Dabei gab es Unterschiede in den künstlerischen Handschriften, im Vermögen und in den Möglichkeiten. Aber nicht die Unterschiede scheinen mir das Wesentliche, vielmehr das unabhängig voneinander und auf unterschiedlichen Wegen gefundene Gemeinsame: Auffällig zunächst der große Einsatz der Ensembles, mit dem sie sich das beglückende Erlebnis erspielen, gebraucht zu werden — dadurch, daß sie ihrer Gesellschaft den Spiegel vorhalten, vorurteilslos, klar, sauber, ohne Verzerrungen, also unmißverständlich. Erfreulich sodann, daß keines der Ensembles Ambitionen hegt, mit ästhetizistisch erstarrten Mitteln, mit Ironie oder Distanz seine besondere Klugheit gegenüber den Menschen herauszukehren, die es darstellt. Die Ensembles bekennen sich zu den sozialen Beziehungen und Konflikten, zu den Menschen, also nicht nur zu Tscheschkow, auch zu den Gramotkins, Plushins und Poluektows. Es ist zu reden über Theater der Identifikation.
Wenn Bertolt Brecht die Einfühlung des Zuschauers in die Schicksale der Bühnenhelden als überholte Methoden attackierte und Verfremdung als Kommunikationsmittel zwischen Bühne und Zuschauerraum etablierte, damit der Zuschauer mit dem Urteil zwischen die Bühnengeschehnisse zu kommen vermöge, so war dies ein historisch notwendiger Schritt und eine Errungenschaft zugleich. Es war die Negation der überlieferten, kritiklosen Einfühlung, die im spätbürgerlichen Theater geradezu zum Mittel hypnotischer Verführung des Zuschauers geworden war. Unter unseren sozialistischen gesellschaftlichen Bedingungen, aus denen qualitativ neue „Geschehnisse zwischen Menschen" auf die Bühne gelangen, wird die Negation der Negation notwendig, die Wiedergewinnung der Einfühlung auf reicherer, höherer Ebene. Bewahrt werden muß das Verwenden und Erzeugen von Gedanken und Gefühlen, die bei der Veränderung des jeweiligen historischen Feldes menschlicher Beziehungen eine Rolle spielen. Überwunden werden muß die aufgekommene Manier, Figuren und Geschehnisse mehr fremd als erkennbar zu zeigen und das Publikum verwundern statt wundern zu machen. Solcherart Verfremdung versagt angesichts der sich zwischen Zuschauerraum und Bühne herausbildenden neuen Beziehungen, die das erklärte Bedürfnis der Zuschauer signalisieren, am Kampf ihrer Helden teilzuhaben, sich mit ihnen zu identifizieren, sowohl kritisch urteilend als auch von Herzen mitfühlend. Die Publikums-Gespräche belegen: Das Publikum fühlt und bangt mit Tscheschkow, und es denkt mit ihm. Das wache, teils sehr kritische Urteil gegenüber dem Verhalten des Tscheschkow ist gepaart mit Anteilnahme und Sympathie für den mutigen Revolutionär und Kommunisten. Es ist schon bemerkenswert, daß sich Zuschauer die Frage vorlegen, was sie wohl an Tscheschkows Stelle tun würden und wie schwer es ihnen fallen würde, ihm ebenbürtig zu sein. Die Konsequenz ist unübersehbar: Tscheschkow etwa ironisch-distanziert als „Fachidioten" oder „modernen Technokraten" zu zeigen, ginge am Wesen der Figur und des Stücks völlig vorbei. Diesem neuen Inhalt wird nur eine Spielweise gerecht, die dem Zuschauer Identifikation ermöglicht. Identifikation begriffen als dialektische Einheit von Mitfühlen und Werten.
Einen radikalen Versuch macht Ekkehard Kiesewetter in Erfurt. Als würde er dem alten Instrumentarium überhaupt nicht mehr trauen, läßt er sich von Jürgen Müller vier Zuschauertribünen auf die Bühne bauen und in deren Mitte ein karges Spielpodest. Das nervt zwar den einen oder anderen Besucher, der den bequemen Sessel nur ungern entbehrt. Aber nicht darum geht es Kiesewetter, sondern um hautnahes Dransein am Geschehen. Diese Lösung zwingt ihn und seine Darsteller, sehr genau zu arbeiten. Sie müssen viel von Stanislawskis psychologischem Theater in die Arbeit einbringen und nicht weniger von Brechts sozialem Gestus. Sie müssen konkrete, genaue Partnerbeziehungen aufbauen und durchhalten, sie müssen szenisch beredt sein. Konzentration auf Schauspielkunst stellt sich her. Und es gelingen schöne Entdeckungen. Nicht nur Tscheschkows (Hanns-Michael Schmidt) arbeitsbesessene, energische Aktionen in den Neresher Werken werden schaubar, auch die Liebe zwischen ihm und der Stschegoljowa (Doris Dubiel). Tscheschkows tiefe, ehrliche Liebe erzählt seine kaum sichtbar werdende scheue Verlegenheit gegenüber der Stschegoljowa auf dem Fest, bevor sie sich entdeckt haben. Dieser Tscheschkow ist sensibel, aber er hat starke Nerven. Er nimmt sich besonnen Zeit, die hereinplatzenden Kommandeure wieder hinauszuschicken. Politisch empfindsam und tief getroffen setzt er deutlich sein Bekenntnis: Ich bin Kommunist! Da er als ein gefühlsreicher, feinsinnigen menschlichen Regungen zugänglicher junger Mann gezeigt wird, gewinnt er selbst solche Zuschauer für seine Sache, die den spezifischen Problemen eines Werkleiters nicht a priori gewogen sind. Diese Chance haben nicht alle Bühnen konsequent wahrgenommen. Theater der Identifikation bietet die Möglichkeit, Tscheschkow als den beharrlich und zu Recht unduldsam fordernden Fachmann der technischen Revolution und als einen heißspornigen jungen Menschen zu entdecken, der eben nicht das „Ungeheuer" im Betrieb sein möchte, und nicht zuletzt ein liebender Mann ist. Ein Mann, den nach aufreibenden Kämpfen zwei Schläge an den Rand des physischen Zusammenbruchs bringen: das uneinsichtige Wegrennen seiner Mitarbeiter aus der Dienstbesprechung und die Absage der Stschegoljowa in dem Moment, da er sie am dringendsten braucht. Kiesewetter will Faszination, will theatralische Wirkung, mit der er den wesentlichen Inhalt transportieren möchte. Er läßt seine Darsteller zügig Szene für Szene agieren, verzichtet auf die Pause und auf Zwischentexte. Der Zuschauer kann gerade Atem holen, ursprüngliche Spannung kommt auf. Leider fällt sie ab durch den Mißgriff, die Wohnheim-Szene minutenlang in völlige Dunkelheit zu hüllen. Auch wird eine mögliche Steigerung gegen Ende vergeben, wenn Tscheschkow zwar erbittert um seine Kollegen ringt, aber Managarows Befürchtung „Mir gefällt ihr Zustand nicht" überspielt und Tscheschkow nicht an den Rand des völligen physischen Zusammenbruchs getrieben wird. Dadurch gerät das Auftreten Krjukows, des Parteisekretärs aus dem Stadtkomitee, zu dem einer „grauen Eminenz", wird vom Zuschauer kaum als innere Notwendigkeit, Eingreifen der Partei zum richtigen Zeitpunkt, eher als äußerliche deus ex machina-Lösung empfunden.
Читать дальше