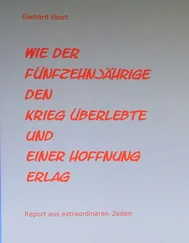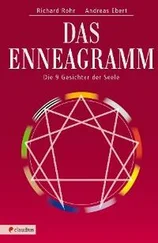Die von Christine Gloger, Sonja Hörbing, Angelika Waller und Barbara Dittus gegebenen Mädchen sind kess und fröhlich gekommen, sie wissen wohl, daß die Verlobung ein Schmarren ist, aber das Gaudi möchten sie sich leisten und vielleicht fällt ein Kaffee ab und ein Tanz. Sie wollen es nicht recht glauben, wenn Matti so seine Bedenken hat. Und noch Puntilas erste bissig herausgestoßene Ablehnung können sie nicht begreifen, bis sie, von Puntilas Gekeif getrieben, den Hof verlassen. Das fügt sich eindrucksvoll in das Komödiantische dieser Inszenierung, wie auch die erkennende Besinnlichkeit der Finnischen Erzählungen.
Ein weiterer Höhepunkt: Evas Verlobung. Carmen-Maja Antoni gibt die Eva als ein spätes Mädchen. Nicht natürliche Sinnlichkeit und junges Begehren treiben diese Eva zu Matti, sondern verschrobene, kalte Berechnung, intellektuelle Potenz. Dadurch stellt sich anschaulich die Klassenbeschränktheit dieser Gutsbesitzerstochter gegenüber der gesunden Natürlichkeit wie sozialen Geradlinigkeit und Ehrlichkeit des Matti her. Bedenklich indes scheint mir, wenn — ausgelöst durch die vehemente Spielfreude des Ensembles — Matti bei seiner Eheprobe auf einmal alle Mühe hat, daß die illustre Verlobungsgesellschaft nicht auf seine, sondern auf Evas Kosten lacht. Ansonsten ist die Turbulenz der Verlobungsfeier glänzendes burleskes Volkstheater. Man mag sich streiten, ob Puntila dem Attache schließlich doch die Schlagsahne aufs Zifferblatt stülpen soll, ob das theatralisch seriös ist; ich bekenne, es passierte, als ich es eben schon nicht mehr erwartete, also genau im richtigen Moment.
Puntila vertreibt den heroisch diplomatischen Attache (Victor Deiß) und schwelgt im Glück. Ist das zu überbieten? Matti baut ihm, den erneut dem Suff Frönenden, einen Hatelma-Berg, wie er noch nie bestiegen wurde: aus dampfendem Küchenherd und erklecklichem Hausrat bis hinauf in die luftige Höhe der Galerie. Das szenische Moment, das Durchstoßen der Galerie von unten her, ist hier allerdings stärker als der mimische Vorgang, so sehr Schall nun auch die Sätze türmt. Hans-Peter Reinecke als Matti, trotzig-fest in der Distanz zum nüchternen, clever verschmitzt im Spiel mit dem betrunkenen Puntila, liefert für mich unaufdringlich etwas von der erhabenen, kreativen Weisheit des Volkes, die sich einstellt, wenn die Tage der Ausbeuter gezählt sind und der Kampf besonnen und taktisch klug geführt werden muß. Wenn er Puntila verläßt, ist er des Taktierens müde.
Die Aufführung erschließt das Stück mit komödiantischem Zugriff, den Klassenantagonismus zwischen Puntila und Matti sinnfällig ausformend, und zwar in dem nach Farbe und Raumaufteilung sehenswerten Bühnenbild von Johanna Kieling.
Theater der Zeit, 6/1975
von Bertolt Brecht,
Theater Prenzlau,
Regie Lutz Günzel
Wertvoller Versuch
„Mann ist Mann" in Prenzlau. „Du bist wie ein Elefant, der das schwerfälligste Tier der Tierwelt ist, aber er läuft wie ein Güterzug, wenn er ins Laufen kommt", sagt Frau Gay zu ihrem Mann. Wer nun einen elefantenstarken Packer Galy Gay erwartet, der kräftige Arme hat, mit denen er beliebig Kisten und Gewichte stemmt, aber nur ein kleines Hirn, das obendrein nicht „nein" sagen kann, sieht sich enttäuscht. Da agiert ein zierliches, scheues Männlein, Erinnerungen an Chaplin und Keaton weckend, treuherzig einfältig, nicht den Widerspruch zwischen arger Kraft und bescheidenem Geist spielend, sondern die verträumte Schüchternheit und unschuldige Weltfremdheit eines versehentlich ins Proletariat geratenen Kleinbürgers. Doch dies vorzüglich.
Wladi Weigl, ein bemerkenswert sensitiver Schauspieler, in den Mitteln sich zwar schließlich wiederholend, gibt ein herrlich naives Unschuldslamm von Galy Gay, das sich wunderschön klug dünkt und auch schon reingelegt ist. Erwartungsvoll drängt er sich zwischen die Soldaten, als er vom Elefanten hört, still freut er sich in sich hinein, wenn er ihn endlich besitzt, als gequältes Seelchen hockt er schließlich in der Latrine. Diesem Gay kann man nicht böse sein, auch dann nicht, wenn er am Ende das Maschinengewehr kampfeswütig auf die Bergfestung Sir El Dchowr richtet. Obwohl er nun eine Maske trägt wie die Soldaten, das Ummontiertsein des naiven Sonderlings mit dem weichen Gemüt zum kriegslüsternen Söldner wird nicht recht nachvollziehbar.
Ich bin nicht gewiß, ob es die Regie überhaupt wollte. Denn Lutz Günzel läßt die Soldaten — in Masken und mit ausladender, stilisiert erzählender Gestik — zwar martialisch im Anspruch agieren, aber immer wieder neckisch verspielt in der Ausführung, selbst von der Kostümierung her (mit Stullentaschen aus der HO, als es in den Krieg gegen Tibet geht). Damit hält er alle Vorgänge konsequent im Vergnüglichen, doch das Vergnügliche wird ein wenig Selbstzweck, unverbindlich, verliert poetischen Sinn. Und Weigls Gay bleibt bedauernswert auch unter der Maske, er ist als Kampfmaschine eher lächerlich als gefährlich. Der Versuch mit Weigl ist dennoch wertvoll, macht auf einen nervigen Schauspieler aufmerksam und auf einen experimentierfreudigen Regisseur.
Günzel verrät Handschrift im Arrangement wie im Fixieren der Figuren. Er fordert, scheint mir, nicht mehr vom Darsteller, als dieser schauspielerisch organisch einzubringen vermag. Er quält die junge Monika Bienert nicht zu einer alten Witwe Begbick. So schreitet sie denn schlank und rank durch das Stück, jugendlich frisch in der Ausstrahlung, forsch in den Bewegungen, zart und angenehm in den leisen Tönen, weniger überzeugend, wenn sie laut und ordinär-herrisch zu sein hätte. Nicht immer übrigens setzt sie klar Spiel vom notwendigen Umbau ab. Auch die munteren Soldaten von Wolfgang Sonnefeld (Uria), Max Grashof (Jesse), Roland John (Polly) und Botho Roge (Jeraiah) nehmen es hierin nicht so genau. Den Blutigen Fünfer gibt Rudolf Spade. Gespielt wird im Prenzlauer Kino, dessen kunstfremde Gegend vor dem Vorhang Brigitte Zeh zu einem stückgemäßen Spielraum umfunktionierte.
+
Während die Wissenschaft — Brecht analysierend — als vier Funktions-weisen sozialistischer Kunst poetische Akklamation und positive Konstruktivität, Sozialanalyse, Gesellschaftskritik und Programmatik etabliert, macht die Praxis — Brecht spielend — auf die nobelste Funktion sozialistischen Theaters aufmerksam: auf die Vergnügung. Ihr willfahrend, gewinnen die Theater neue Einsichten und Mittel. Zwei möglicherweise aufkommende abwegige Tendenzen sollten sie beachten. Einmal die Gefahr, die Vergnügung ihres philosophisch-poetischen Inhalts zu entleeren, z.B. wenn ein Stück einem noch nicht mit Brecht vertrauten Publikum vereinfacht vermittelt werden soll und unversehens mehr der Spaß, zu wenig die tiefere Bedeutung bedient wird. Zum anderen die Möglichkeit, bei einem Stück tiefere Bedeutung zu postulieren als ihm heute angemessen, wodurch es überfrachtet wird und seinen besonderen ästhetischen Reiz verliert.
Erfreulich insgesamt, daß offenbar wieder mehr Theater die Begegnung mit Brecht suchen, darunter auch kleinere. Das neue Publikum trachtet, Brecht als seinen Dichter zu besitzen. Und eine neue Generation von Schauspielern und Regisseuren erkundet den großen sozialistischen Realisten von der Position der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und wächst an ihm, politisch und künstlerisch. Neue Inszenierungen sind angekündigt, unsere Eindrücke werden zu ergänzen sein.
Theater der Zeit, 6/1975
„Prinz Friedrich von Homburg“ und „Der zerbrochne Krug“
von Kleist,
Deutsches Theater Berlin,
Regie Adolf Dresen
Kleist ohne Patina
Es fehlt nicht an spektakulären Versuchen, das hauptstädtische Theater attraktiv zu machen. Das Ungewöhnliche ist in der Tat ein starker Stimulus für Publikumsgunst. Auch solch Einfall: Drei Premieren an drei aufeinanderfolgenden Abenden. Wen macht das nicht neugierig? Nun also zwei Stücke an einem Abend. Auf daß wir Kleist absitzen! Vier Stunden ausharren bei diesem Vaterländischen ohne Vaterland? Vier Stunden müde Assoziationen zu verstaubten Idealen und Maximen? Mitnichten! Ein exzellenter Theaterabend mit einem großen Tragikomiker, dem größten deutscher Dramatik, aufbereitet von Adolf Dresen. Das ist das Erfreuliche: Der Abend ist attraktiv in der Substanz, im mimetischen Kern.
Читать дальше