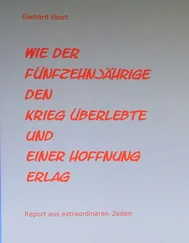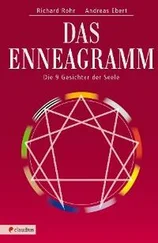„Der Prinz von Homburg", schrieb Herbert Jhering vor fünfzig Jahren, wird „erst dann in letzten Geheimnissen seiner Form geahnt werden, wenn er im politischen Tagesstreit nicht einmal zu Mißverständnissen mehr Anlaß geben kann." Eben dies stellt sich her. Die Händel zwischen Homburg und Friedrich Wilhelm sind heute nicht mehr unmittelbar von Belang. Unser freier, dialektisch geschulter Blick enthüllt am kasuistisch starren Dogma des brandenburgischen Herrschers komische Züge. Und Dresen hilft, sie als realistische Entdeckungen Kleists zu erkennen.
Hatte also Franz Mehring unrecht, als er das Stück „das hohe Lied der Subordination unter den königlichen Willen" nannte? Er hatte recht, solange es als dieses Lied interpretiert wurde. Heinrich von Kleist hat es offenkundig nie so gemeint, zumindest wird das nach dieser Inszenierung unter epochaler Patina sichtbar. Kleist stammte aus preußischer Offiziersfamilie, aber er hatte mit seinem Abschied von der Armee auch Abschied genommen vom preußischen Reglement. Mit seinem „Homburg" sann er auf Polemik gegen dynastisch beschränkte Politik, die Zeichen der Zeit poetisch deutend. 1809 hatte Schill ohne Befehl des Königs auf eigene Faust losgeschlagen. 1809 hatte sich Blücher bereit erklärt, ohne Befehl des Königs zu handeln. Des Monarchen absolute Gewalt erwies sich in der Wirklichkeit als relativ.
Nun ritt Kleist seine dramatische Attacke, mit der er eben dies weithin publik zu machen suchte. Zwar obsiegt Subordination im äußeren Ablauf des Stückes, aber die Fabel erzählt mehr: Die Sternstunde einer vitalen Persönlichkeit, die im ursprünglichen Drange ihres Menschseins stupide gesellschaftliche Normen unfreiwillig ad absurdum führt. Homburg, der traumwandelnde General der Reiterei, tatendurstig im seelischen Höhenflug seiner Liebesromanze, provoziert arge Verlegenheit bei Hofe. Unversehens hat der Kurfürst alle Mühe, in Sachen militärischer Gehorsamspflicht ein Exempel zu statuieren. Und Kleist sorgt, daß der Herrscher — wenn er schon eine glückliche Hand hat — ob seiner geistigen Haltung komische Figur macht. Der Kurfürst legt den unerfahrenen Homburg taktisch clever aufs Kreuz, doch wohl nicht das lebenserfahrene Publikum.
Dresen holt die Patina vom Stück, indem er sozial konkret spielen läßt, jeder Figur seelischen Reichtum und unverwechselbare gestische Züge gibt. Er macht des Dichters historische Klugheit schaubar, ohne dessen objektive Beschränktheit hämisch anzumerken. So gewinnen die Figuren lebendige Plastizität, sie werden nicht gezeigt, sie dürfen spielen. Und das Spiel begibt sich straff und zügig, ohne falsches Pathos, mit komödiantischer Verve.
Homburg wirkt in der Darstellung von Alexander Lang wie ein sensibler großer Junge, der unbesonnen über die Stränge schlägt. Nonchalant-verträumt disputiert er mit Freund Hohenzollern, burschikos erkundet er die Sache mit dem Handschuh. Verliebtheit und aufkommende Gewißheit sind allemal wichtiger als subalterner Befehlsempfang. Zu spät kommt er zur Schlacht, schlaksig, ahnungslos, den Mantel zerknautscht — zivil geschnürt, die Waffe beiläufig gegürtet, den Hut eher wie für ein charmantes Abenteuer in die Stirn gezogen. Nun wird da also gekämpft. Sieh da! Und im Höhenflug seiner verliebten Seele stürzt er sich ins Getümmel, das Opfer seiner ganz und gar unpreußischen Phantasie. Er muß mit der Staatsraison kollidieren, früher oder später — so sehr er sich dann an eben diese klammert, der treue und herzige Sohn seines Herrschers.
Den Kurfürsten gibt Dieter Franke, stier-nackig, rabulistisch, die Verse herauswetternd, ein kampfeslustiger Souverän. Siegessicher setzt er sich zurecht, der Absolute, um die aufsässigen Generale zu empfangen, keinen Schritt gedenkt er zu weichen, und gerade das macht ihn komisch, gibt dem Stück seine Dimension. Den akkuraten, redlichen Graf Hohenzollern spielt Klaus Piontek, sprachlich vorzüglich, distinguiert in der Geste. Gerhard Bienert als Obrist Kottwitz argumentiert mit Herz und Witz, ein markanter Widerpart dieses Kurfürsten. Bärbel Bolle verströmt Liebreiz und Gefühl, eine emotional reiche Natalie. Wenn der Inszenierung in dem preußisch-strengen wie romantisch-zarten Bühnenbild von Hans Brosch letztlich der große Glanz versagt bleibt, dann wegen der gelegentlichen Mühen der Darsteller mit Kleists Versen. Zur Poesie des realistischen Vorganges gesellte sich nicht die klare Schönheit der Kleistschen Sprache, insofern blieb ein „letztes Geheimnis" der Form noch immer unerschlossen.
Erschlossen in reichem Maße, auch sprachlich, wurde „Der zerbrochne Krug", die Geschichte vom Dorfrichter Adam, im sachlich-dienlichen, Spielräume gewährenden Bühnenbild von Hans Brosch. Zwar boten die Repliken des Mißverständnisses und der Verdrießlichkeit am Anfang des Stückes ein Aneinandervorbeireden ohne gemäßen darstellerischen Ausdruck, fast so etwas wie verschmitzte Kleistsche Vorwegnahme absurden Theaters, doch fand sich das Spiel bald zu großer schauspielerischer Akribie.
Dieter Franke vor allem reihte als Dorfrichter Adam mimische Erfindung an mimische Erfindung, ein Feuerwerk an Einfällen, ohne sich zu wiederholen, die Figur auf grandiose Weise ausschöpfend. Da argumentiert und gestikuliert ein ausgekochter Opportunist, provinziell zwar, dörflich-muffig, grobschlächtig, aber aalglatt, trotz Klumpfuß leichtfüßig, flink mit der Zunge, noch flinker mit den Augen, geradezu unerschöpflich in der Beredsamkeit seiner Hände. Er biedert sich an und er tritt ins Fettnäpfchen, er streichelt die Volksseele und er tritt sie mit seinem Klumpfuß, er wird in die Enge getrieben, alle Felle schwimmen ihm davon, er aber sinnt unverdrossen, das Ding zu seinen Gunsten zu drehen.
Bemerkenswert auch hier, daß Regisseur Dresen keine Figur denunziert, daß er sie plastisch, organisch agieren läßt, empfunden aus den konkreten sozialen Bedingungen, doch ohne den sozialen Gestus wie ein Korsett über die Figuren zu schnüren. So entfesselt er ursprüngliches, kreatives Theaterspiel. Selbst der ironisch abgesetzte Schluß, den rabiaten Zugriff Ruprechts relativierend, fügt sich in diese kommunikative Spielweise. Da ist kein vertrottelter, vordergründig „preußischer" Gerichtsrat Walter zu sehen, vielmehr ein um das Ansehen der Gerichtsbarkeit ringender aristokratischer Beamter, von Dietrich Körner mit vornehmer Zurückhaltung und spitzer Polemik ausgewogen gespielt. Zugunsten der enthüllenden Heiterkeit des Lustspiels gerät das Duell zwischen Adam und Walter possierlicher als das zwischen Adam und Frau Marthe.
Allerdings gibt Elsa Grube-Deister die Marthe zwar rechtschaffen aufgebracht, aber zu wenig selbstbewußt, ihr fehlt Härte und Deftigkeit. Alexander Langs Ruprecht ist nicht von schneller Zunge, bedächtig und ein wenig einfältig spult er seinen Bericht herunter, der Figur einen eigenen Reiz aufkeimender Selbstbewußtheit gebend, die sich schließlich in handgreiflicher Tat entlädt. Prächtig der Licht von Klaus Piontek. Wie er seine Chance wittert, wie er nichts falsch machen möchte, wie er hellwach das Geschehen verfolgt, um sich gegebenenfalls ins rechte Licht setzen zu können, das ist genau gefunden und glänzend gespielt. Bärbel Bolle gibt die Eve deutlich mit der scheuen Zurückhaltung einer in den Fall Verstrickten, aber insgesamt doch wohl zu brav, zu sehr als bieder-holde Tugendsame, die sie wahrhaftig nicht ist. Mathilde Danegger als die den Teufel ahnende Frau Brigitte bringt schön die milde geistige Beschränktheit dieser Figur ins Spiel.
Schien das Anbieten beider Stücke an einem Abend zunächst nur ein äußerer Einfall, fügte der Interpret Dresen doch eine interessante Klammer: Der adlige Homburg nutzt seine spontane Tat, brandenburgische Interessen daran zu knüpfen, soziale lediglich als „Traum" vermutend; Ruprecht hingegen, der Bauer, schreitet zur Tat, spontan auch, aber nicht impulsiv-verträumt, sondern erkennend, irdisch-kräftig, mit sozialer Stoßrichtung. (Bei Kleist bezieht sich Homburgs „Nein sagt! Ist es ein Traum?" auf seine unerwartete Rettung, Dresen gibt diesem Satz vielsagenderen Sinn.)
Читать дальше