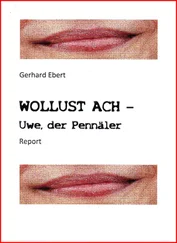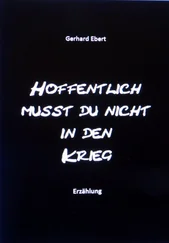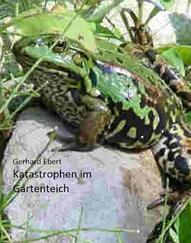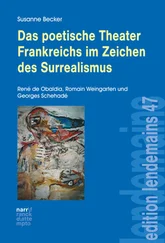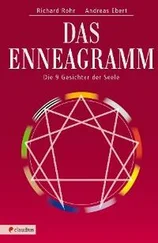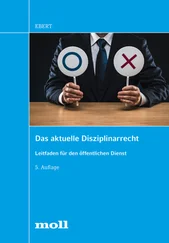In Berlin war die reiche Erlebnis- und Gefühlswelt der Figuren auf die deutbare Gestik reduziert worden. In Leipzig wurde ein einfacher, sachlicher, aber die poetische Fülle der Gestalten nachzeichnender Stil gefunden, der Schwächen des Stückes verdeckt. Es stört hier weder die Aufteilung der Handlung in viele Entwicklungsstationen noch Hannas zweite Schwangerschaft.
Allerdings kann auch Smiszek aus der Hanna Tainz keine positive Heldin machen. Das Stück endet nun einmal in dem Moment, in dem Hanna sich vom Bewußtwerden zur Aktivität durchringt, in dem sie nach vielen quantitativen Veränderungen zur historisch entscheidenden neuen Qualität vorstößt. Daher wird auch in Leipzig unser Wunsch bestärkt, einmal diese neue Hanna erleben zu können — in ihrer Liebe und in ihrem Haß, in ihrer Arbeit für die Gesellschaft und für ihr Kind. Wir möchten unsere Bitte an den Dichter, die wir schon anläßlich der Uraufführung aussprachen, hier wiederholen: Strittmatter möge uns bald ein Drama schenken, das den Helden der sozialistischen Landwirtschaft ein bleibendes Denkmal setzt.
SONNTAG, Nr. 10/1962
von Georg Büchner,
Volkstheater Rostock,
Regie: Hans Anselm Perten
Ganz nahe an unserem Herzen
Nach vielen Jahren platonischer Diskussionen hat das Volkstheater Rostock mit einer kühnen und aufsehenerregenden Inszenierung von „Dantons Tod" hinweggeräumt, was uns die Sicht auf dieses geniale Werk verstellte. Chefdramaturg Kuba hat recht, wenn er im Programmheft schreibt: „Im ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat ... ist Georg Büchner aus dem Exil heimgekehrt — auch wenn er es mit seinem größten und reifsten Drama ,Dantons Tod' am sozialistischen Theater noch schwer hat, sich durchzusetzen."
Dieses „sich durchsetzen" umschreibt den Prozeß der schöpferischen Aneignung des Erbes, der in seiner Kompliziertheit nur zu verstehen ist aus der widersprüchlichen Entwicklung unserer sozialistischen Theaterkunst. Je weiter diese sich entfalten wird — wobei das Publikum hier einbezogen ist —, desto selbstverständlicher und leichter wird sich Büchners Drama durchsetzen.
Kuba und Perten hielten es mit Büchner, der erklärt hatte: „Ich betrachte mein Drama wie ein geschichtliches Gemälde, das seinem Original gleichen muß." Das heißt, sie beachteten vor allem das elementare Aufbrechen des Volkswillens in der bürgerlichen französischen Revolution, die nach Lenin „für ihre Klasse, für die sie wirkte, nämlich für die Bourgeoisie", so viel geleistet hat, „daß das ganze 19. Jahrhundert, ... unter dem Zeichen der Französischen Revolution stand." Kuba und Perten stellten das Werk in seine konkreten historischen Zusammenhänge.
Und dabei enthüllte sich die außerordentliche poetische Kraft und Weitsicht Büchners. Der Dichter hat die wesentlichen Züge der konkreten Etappe der Revolution geliefert. Und die Elemente, die so gern als Beweis für die konterrevolutionäre Tendenz des Werkes ausgegeben werden, sind bei genauerem Hinsehen nichts anderes als die historisch getreue Spiegelung der Relativität der bürgerlichen Revolution in ihren heroischen Tagen. Die Großbourgeoisie haßte die Rousseauschen Ideen, sie haßte auch deren Verfechter, die Jakobiner, sie hatte nur das eine Ziel: Freiheit für die Aus-beutung, Freiheit für Spekulation, Korruption und Sittenlosigkeit. Eben diese Relativität gibt Büchner durch die bewußte Gestaltung der Progressivität der Jakobiner-Diktatur.
Kubas und Pertens Konzeption konzentrierte sich folgerichtig auf die sogenannte „Blutrede" St. Justs. Sie ist ohne Zweifel der Kern des Dramas, die poetische Idee. In ihr spiegelt sich Büchners Wertung der bürgerlichen französischen Revolution.
Der junge Dichter hatte sich bekanntlich vor den Schergen der deutschen Reaktion hüten müssen. Die Arbeit am „Hessischen Landboten" hatte zu Vorladungen vor das Kriminalgericht geführt. Büchner bereitete die Flucht aus Deutschland vor. Und um Geld in der Hand zu haben, schrieb er im Frühjahr 1835 in fünf Wochen „Dantons Tod". In das Drama floß sein Haß auf die feudalen Zustände in Deutschland, aber auch seine Trauer über die Bedingtheit des revolutionären Fortschritts in Frankreich und sein Suchen nach einem Weg in die Zukunft.
Im November 1833 hatte Büchner in einem Brief geschrieben: „Ich studierte die Geschichte der Revolution. Ich fühle mich wie zernichtet unter dem gräßlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, allen und keinem verliehen. Der einzelne nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genius ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich..."
Wollen wir angesichts dieser Gedanken mit dem Büchner des Jahres 1833 rechten, wenn uns noch heute Zeitgenossen begegnen, die den dialektischen Zusammenhang zwischen Mensch und Gesellschaft nicht begreifen? Das ist kein unschicklicher Vergleich, das ist genau die Frage Büchners! Und sie zielt bei ihm bereits auf die Erkenntnis, daß es einen Zusammenhang geben muß, „ein ehernes", ein objektives Gesetz, „es zu erkennen das Höchste..."
Büchner erreichte nicht dieses Höchste. Er konnte nicht wie Karl Marx und Friedrich Engels wenige Jahre später eine wissenschaftliche Antwort geben. Aber seine poetische Antwort ist nicht etwa ein Verzagen, ist weder Fatalismus noch Nihilismus, sondern Vorstoß zu absoluter Wahrheit. Büchners Antwort ist die „Blutrede" St. Justs. Mit ihr überwindet der Dichter seine „Zernichtung" aus dem Jahre 1833 und bekennt sich rückhaltlos zur Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, zur Revolution. Diese Rede ist Büchners moralische Legitimation der "Jakobiner-Diktatur. Sie gipfelt in dem Ausruf: „Die Revolution ... zerstückelt die Menschheit, um sie zu verjüngen. Die Menschheit wird aus dem Blutkessel wie die Erde aus den Wellen der Sündflut mit urkräftigen Gliedern sich erheben, als wäre sie zum ersten Male geschaffen." Das sind drastische Worte, das ist aber vor allem die Erkenntnis, daß die bürgerliche Revolution — bei aller Relativität — eine neue Qualität der Menschheitsentwicklung gebiert.
Und das Drama ist nun nicht etwa die Zurücknahme dieser Rede St. Justs, sondern ihre Bestätigung. Büchner hat nicht die Niederlage der Jakobiner vom 9. Thermidor 1794 gestaltet, sondern deren revolutionäres Zuschlagen im Interesse der Revolution und mit Unterstützung der Volksmassen.
Danton, der gefeierte Volkstribun im Kampf gegen die feudale Konterrevolution, der Held des September 1792, Danton, der Revolutionär, begibt sich auf die Seite der Großbourgeoisie. Er ist für die Jakobiner-Diktatur zwangsläufig ein Konterrevolutionär, aber im Sinne der bürgerlichen Revolution bleibt er ein Revolutionär. Denn: „Die bürgerliche Revolution stand nur vor einer Aufgabe", schrieb Lenin, „alle Fesseln der früheren Gesellschaft abzuwerfen und zu vernichten. Jede bürgerliche Revolution, die diese Aufgabe erfüllt, erfüllt alles, was man von ihr fordert: Sie stärkt das Wachstum des Kapitalismus". Danton macht sich faktisch zum Sprecher jener Bourgeois, die ihr Ziel erreicht und diese „eine Aufgabe" gelöst sahen. Nichts wäre daher falscher, als Danton einseitig als verurteilungswürdigen Konterrevolutionär zu spielen.
Zu zeigen ist der Kampf zwischen den verschiedenen Schichten der revolutionären Bourgeoisie, zwischen dem Jakobinertum, einer „der Höhepunkte im Befreiungskampf der unterdrückten Klasse" (Lenin), repräsentiert durch Robespierre, St. Just und die Volksmassen und der in der Revolution reich und behäbig gewordenen Großbourgeois, vertreten zum Beispiel durch Barrère und Collot d'Herbois, die noch im Hintergrund bleiben können, weil ein anderer — mehr oder weniger unbewußt — ihr Geschäft besorgt: Danton. Mit ihm „testet" die Großbourgeoisie die Stabilität der Jakobiner-Diktatur. Danton wird zum Spielball der um die Macht kämpfenden Kräfte. Er erkennt das schließlich selbst. Im Gefängnis sagt er einmal: ,,...es ist mir, als wäre ich in ein Mühlwerk gefallen..."
Читать дальше